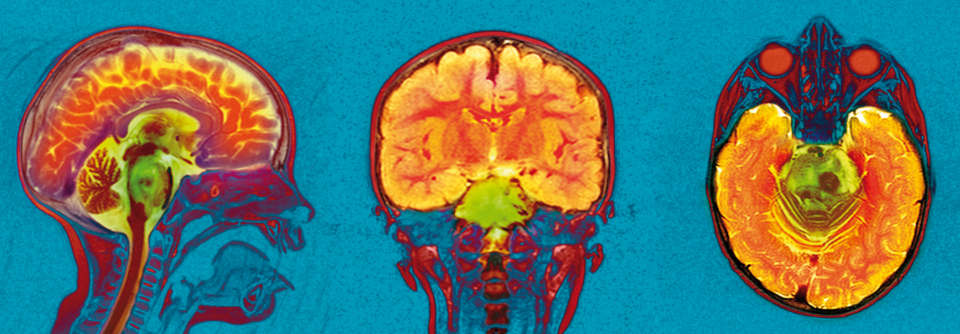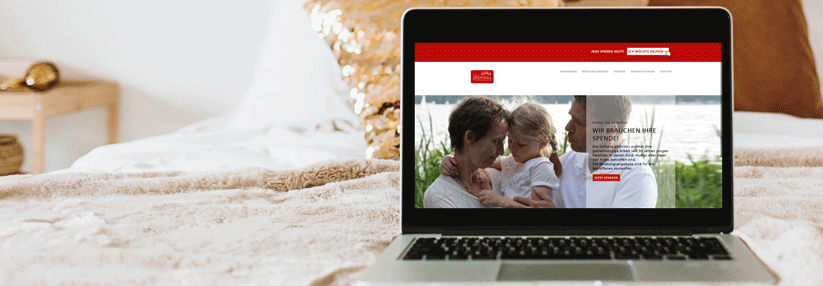
Interview mit Barbara Grießmeier Psychosoziale Nachsorge von Kindern mit Krebs ist längst kein Standard
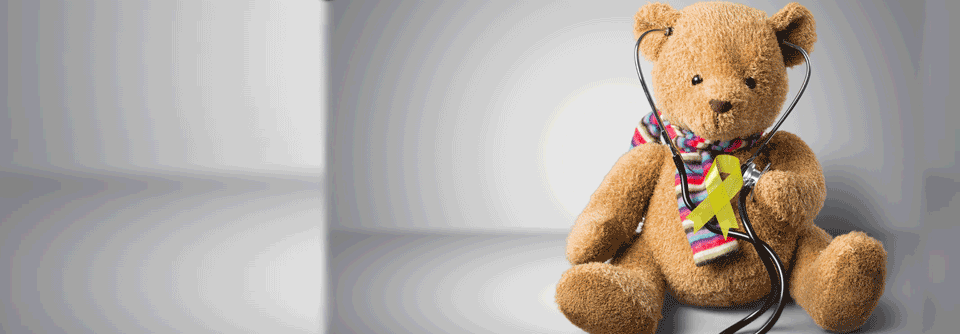 Barbara Grießmeier erläutert in einem Interview, was in der psychosozialen Nachsorge bei Krebsdiagnosen von Kindern unbedingt verbessert werden muss.
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Barbara Grießmeier erläutert in einem Interview, was in der psychosozialen Nachsorge bei Krebsdiagnosen von Kindern unbedingt verbessert werden muss.
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com
Unter welchen psychischen Belastungen leiden Kinder und Jugendliche mit einer Krebserkrankung?
Barbara Grießmeier: Die Belastungen hängen stark vom Alter ab. Sehr junge Kinder können die Diagnose nicht einordnen und haben nur ein gering ausgeprägtes Krankheitsverständnis. Für sie steht wahrscheinlich der Klinikaufenthalt im Vordergrund und die Tatsache, dass sie nicht einfach nach Hause können. Natürlich stellen auch die medizinischen Maßnahmen, die unangenehm bis schmerzhaft sein können, einen großen Einschnitt dar. Mit zunehmendem Alter verstehen die Kinder die Krankheit besser und damit kommt die Bedrohung des eigenen Lebens ins Spiel. Für die Betroffenen verändert sich der Alltag für die Dauer der Therapie komplett und er orientiert sich ausschließlich an den Erfordernissen der Behandlung. Auch die soziale Isolation ist eine tiefgreifende Veränderung, denn die Kinder gehen während der Zeit nicht zur Schule oder zum Kindergarten.
Psychische Diagnosen wie Depressionen erleben wir bei den jungen Patient:innen nur sehr selten. Es handelt sich vielmehr um absolut nachvollziehbare Reaktionen auf ein schweres Lebensereignis. Natürlich kommt es vor, dass manche eine depressive Verstimmung entwickeln, vor allem die Jugendlichen – aber meist erst dann, wenn sie sehr lange im Krankenhaus bleiben müssen oder die Therapie nicht so anschlägt, wie man es sich erhofft.
Was belastet die Angehörigen besonders?
Grießmeier: Für die Eltern ist die eigene Hilfslosigkeit und das damit verbundene Gefühl von Ohnmacht wohl eine der schlimmsten Erfahrungen. Auch ihr Kind leiden sehen zu müssen und die Sorge, dass es die Lebensfreude verliert.
Wie werden Betroffene unterstützt?
Grießmeier: Die psychosoziale Versorgung der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien gehört heute zum Standard. Psychosoziale Dienste setzen sich meistens zusammen aus Psycholog:innen, Sozialarbeiter:innen und manchmal Diplom-Pädagog:innen. Denn die Betroffenen benötigen beides: seelische und organisatorische Hilfe.
Da die Therapien oft mindestens ein halbes Jahr dauern, muss das gesamte Familienleben umgeplant werden mit Fokus auf dem kranken Kind. Im Prinzip braucht es einen Elternteil, der rund um die Uhr zur Verfügung steht und deshalb nicht arbeiten gehen kann. Erfahrene Sozialarbeiter:innen wissen, welche praktischen Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie man diese beantragt. Anders als in der Erwachsenenonkologie geht der psychosoziale Dienst hier aktiv auf die Familien zu.
Für Eltern bestehen weiterführende Angebote (s. Kasten). Die meisten Kliniken bieten zudem eine Musik- und/oder Kunsttherapie an. Gerade diese nonverbalen Behandlungsformen wirken sehr positiv, sei es hinsichtlich des Ausdrucks von Emotionen oder im sozialen Miteinander. Sie werden leider fast ausschließlich durch Eltern- oder Fördervereine finanziert. Auch Sport- und Bewegungstherapien können die Kinder sehr gut unterstützen.
Welche Hilfen bieten psychosoziale Dienste in den einzelnen Phasen der Erkrankung?
Grießmeier: Nach der Diagnosestellung werden Belastungen sowie Ressourcen der Familie evaluiert. Dabei spielen neben der Krankheit auch unabhängige Probleme eine Rolle – eine kürzliche Trennung der Eltern, finanzielle Probleme, der Tod eines Familienangehörigen usw. Die Eltern muss man anfangs so weit stabilisieren, dass sie für ihr Kind da sein können. Im Verlauf der Therapie lernen sie, was im Kontext der Krankheit und in deren Verlauf „normal“ ist und was nicht. Wir vermitteln den Angehörigen, dass all ihre Gefühle angemessen sind und helfen, diese einzuordnen bzw. damit umzugehen und halten ein kontinuierliches Gesprächsangebot aufrecht. Nach ca. drei Monaten setzen wir uns nochmals zusammen, um die aktuelle Situation und Anliegen zu besprechen. Gegen Ende der Therapie erfolgt eine Rehaberatung und wir versuchen, die Familien bei der Rückkehr in die Normalität zu begleiten.
Wie sollten Onkolog:innen und Eltern mit den Kindern sprechen?
Grießmeier: Sie sollten möglichst normal mit ihnen umgehen. Generell vertreten wir in der pädiatrischen Onkologie die Meinung, dass die Kinder wissen sollten, warum sie krank sind – das umfasst auch Informationen, wie die Krankheit heißt und was man dagegen tun kann. Wir vermeiden aber, von „bösen“ Zellen zu sprechen, sondern sagen lieber „verrückt gewordene Zellen“ oder „Zellen, die nicht mehr das tun, was sie eigentlich tun sollen“. Es gibt eine sehr schöne Broschüre namens „Prinzessin Luzie und die Chemoritter“, die Ärzt:innen und Eltern im Zuge der Kommunikation mit den krebskranken Kindern unterstützt. Diese kann man kostenfrei auf der Seite der Kinderkrebsstiftung bestellen (s. Kasten).
Weiterführende Unterstützungsangebote
- www.kinderkrebsinfo.de bietet Betroffenen Tipps und weitere Unterstützungsangebote
- In nahezu allen Kliniken stellen Elternvereine/Fördervereine unterschiedliche und niedrigschwellige Hilfen bereit – z.B. Angebote für Geschwister und die Nachsorge
- Die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe, der Dachverband der Elternvereine, hat eigene Angebote, z.B. das Waldpiratencamp für krebskranke Kinder, Jugendliche und Geschwister
- Link zur Broschüre „Prinzessin Luzie und die Chemoritter“ bit.ly/Chemoritter
Wie wird der psychosoziale Dienst finanziert? Gibt es Möglichkeiten der psychosozialen Nachsorge?
Grießmeier: Die psychosozialen Dienste sind zwar Standard, sie werden aber bisher nicht im Rahmen des DRG-Systems refinanziert. Das ist noch immer Sache der Kliniken. Ein Großteil der Stellen finanziert sich über Drittmittel, v.a. über Elternvereine. In meinen Augen eine absolut unangemessene Situation – auf der einen Seite wird die Wichtigkeit der psychosozialen Dienste hervorgehoben, auf der anderen Seite gibt es dafür aber kein Geld.
Zudem umfasst die Versorgung in den Kliniken meist nur die akute Therapie. Einzelne Kliniken haben Stellen für die psychosoziale Nachsorge geschaffen, manchmal finanziert sie sich durch Elternvereine. Nur ist das lange kein Standard.
Können Sie etwas zum Risiko der Kinder sagen, dass sie später psychische Probleme entwickeln?
Grießmeier: Es ist schwierig, herauszufinden, welche Kinder später psychische oder körperliche Probleme bekommen und eine spezielle Nachsorge benötigen. Häufig trifft es jene mit Hirntumoren, aber gerade für sie gibt es nahezu keine Hilfsangebote. Tragen Kinder durch die Erkrankung dauerhafte Veränderungen oder Einschränkungen mit sich, kann das negativ auf die Psyche wirken. Teilweise treten die Probleme erst nach Monaten oder Jahren auf, und man weiß nicht, wie und wo man die Kinder außerhalb der Klinik angemessen unterstützen kann. Aufgrund der Therapie werden manche Patient:innen infertil und die Lebensplanung ändert sich komplett. Das kann ebenfalls psychosoziale Folgen haben – und auch hier fehlen Angebote. Wir müssen entsprechende Netzwerke aufbauen, um besser helfen zu können.
Interview: Dr. Miriam Sonnet