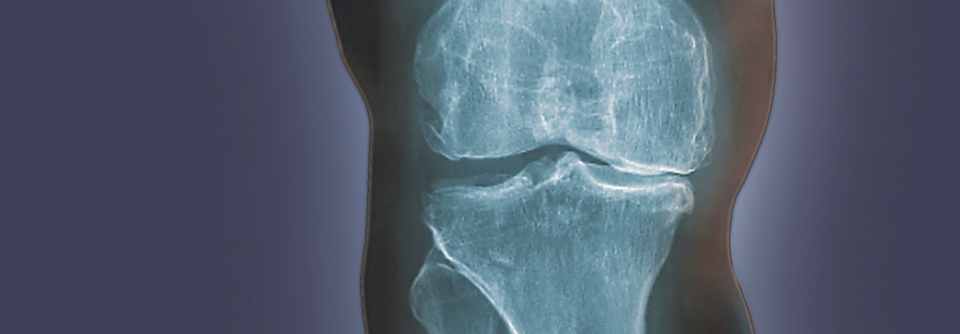Vom Gehstock bis zum Kunstgelenk So macht man der Gonarthrose Beine
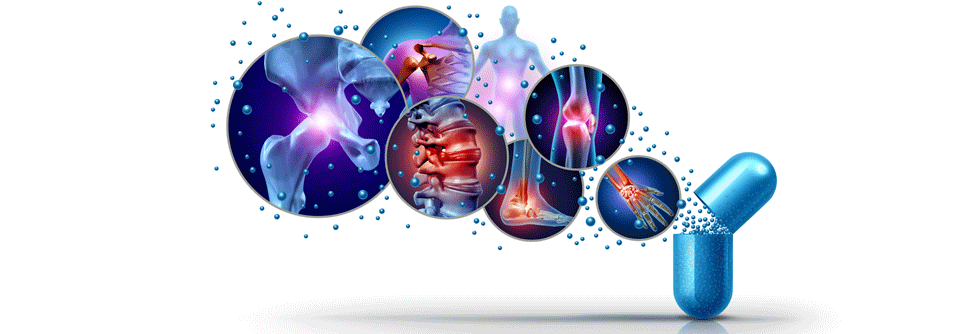 Die medikamentöse Behandlung der Gonarthrose sollte, wenn erforderlich, immer in Kombination mit nichtpharmakologischen Maßnahmen erfolgen.
© freshidea - stock.adobe.com
Die medikamentöse Behandlung der Gonarthrose sollte, wenn erforderlich, immer in Kombination mit nichtpharmakologischen Maßnahmen erfolgen.
© freshidea - stock.adobe.com
Die medikamentöse Behandlung der Gonarthrose sollte, wenn erforderlich, immer in Kombination mit nichtpharmakologischen Maßnahmen erfolgen und die Bewegungstherapie unterstützen. Zudem gilt die Regel: niedrigst wirksame Dosis und kürzest möglicher Zeitraum. Primär sollte man Betroffenen topische NSAR zum Auftragen anbieten. Aufgrund der ausgeprägten Ökotoxizität von Diclofenac ist es wichtig, nach Anwendung (also vor dem Händewaschen) die Hände mit einem Tuch zu reinigen und dieses im Restmüll zu entsorgen. Sind orale NSAR erforderlich, empfiehlt sich bei erhöhtem gastrointestinalem Risiko parallel ein Magenschutz.
Metamizol sollte nur bei starken Schmerzen angewendet werden, und nur falls andere analgetische Maßnahmen ungeeignet, kontraindiziert oder nicht wirksam sind, so die DGOU* und weitere Fachgesellschaften einschließlich der DGAM. Zu Glucosamin gibt es bisher keinen sicheren Beleg für einen chondroprotektiven Effekt. Widersprüchliche Evidenz existiert zu intraartikulären Injektionen mit Hyaluronsäure, sie können deshalb nicht empfohlen werden, so das Expertengremium. Plättchenreiches Plasma kommt nur in Betracht, wenn andere analgetische und funktionsverbessernde Maßnahmen nicht möglich, kontraindiziert oder unwirksam sind. Gleiches gilt für die kurzzeitige Therapie mit intraartikulär injizierten Glukokortikoiden.
Tapes, Schuhzurichtungen und Orthesen nur in Einzelfällen
Einfache Hilfen wie Gehstöcke können das arthrotische Kniegelenk entlasten. Von einem routinemäßigen Tape-Einsatz rät die Leitlinie ab. Dieser kann aber erwogen werden, wenn eine Instabilität oder abnorme biomechanische Belastung vorliegt und therapeutische Übungen ohne Tape unwirksam oder nicht geeignet sind – immer vorausgesetzt, es ist eine Verbesserung der Gelenkfunktion zu erwarten. Auch Schuhzurichtungen und Orthesen sollten nur in Sonderfällen (z. B. ausgeprägte Instabilität) Verwendung finden.
Eine manuelle Behandlung ist nur zusammen mit Bewegungstherapie sinnvoll, für den Nutzen einer alleinigen Applikation gibt es nur unzureichende Belege. Ein zusätzliches Edukationsprogramm und Maßnahmen zur Verhaltensänderung können den Erkrankten mobil halten. Sport ist empfehlenswert, muss aber an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Für Massage, Vibrationstherapie und die apparative Traktionsbehandlung reicht die Evidenz für eine Empfehlung nicht aus.
Manchmal ist Melden Pflicht
Die Gonarthrose kann als Berufskrankheit auftreten (Nr. 2112). Im begründeten Verdachtsfall müssen Ärztinnen und Ärzte dies dem Unfallversicherungsträger oder der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stelle melden.
Als gelenkerhaltende Operation eignet sich die korrigierende Tibiakopfosteotomie (HTO). Von dieser können Personen mit klinisch und radiologisch bestätigter Gonarthrose (Kellgren-Lawrence-Grad ≤ 3°) und tibialer extraartikulärer Varusfehlstellung profitieren. Wenn Menschen vor der Entscheidung für oder gegen eine Endoprothese stehen, empfiehlt das Autorenteam eine Aufklärung über die individuell empfohlene Technik (Funktion, Implantattyp, Patellaersatz etc.) und den typischen Behandlungsablauf. Am besten fragt man die Kandidatinnen und Kandidaten explizit nach ihren Erwartungen und nennt die Wahrscheinlichkeit, mit der sich diese erfüllen werden.
Rauchenden ist vor dem Eingriff eine mindestens vierwöchige Nikotinkarenz ans Herz zu legen, Menschen mit Diabetes eine gute Einstellung (HbA1c ≤ 8 %). Patientinnen und Patienten mit Depression oder schlechter mentaler Gesundheit sollten wissen, dass sie mit einem ungünstigeren Ergebnis (Schmerz, Funktion) rechnen müssen, evtl. ist eine vorherige Optimierung der Therapie sinnvoll.
Bei bestätigter Metallallergie rät die Leitlinie zur Aufklärung über das sehr geringe Komplikationsrisiko von Standardimplantaten. Allerdings bergen die meisten Allergieimplantate insgesamt eine gewisse Revisionsrate. Beide Gefahren sollten gegeneinander abgewogen werden. Mit Einverständnis der allergischen OP-Kandidatinnen und -Kandidaten dürfen Standardimplantate verwendet werden.
Teilprothesen bei Übergewicht mit höherer Komplikationsrate
Übergewichtige mit unikondylärer Endoprothese tragen ein erhöhtes Revisions- und Komplikationsrisiko. Der Gewinn an Funktion und Lebensqualität entspricht dem bei Normalgewichtigen. Die Leitlinie empfiehlt, darauf hinzuweisen und die Indikation bei einem BMI > 40 kg/m2 und ggf. weiteren Risikofaktoren besonders kritisch zu prüfen. Ein generelles Vorenthalten unikondylärer Implantate sei nicht gerechtfertigt, so das Leitliniengremium.
Bei Erkrankten, die eine Totalendoprothese bekommen, können kreuzbandresezierende und -erhaltende Implantate verwendet werden – ohne Unterschiede bei klinischen und funktionellen Ergebnissen und Komplikationen. Als Gelenkersatz eignen sich (teil-)zementierte und zementfreie Varianten – Differenzen bezüglich Resultat, Komplikationen und Reoperationen sind nicht zu erwarten. Zusammen mit dem Einsatz einer Knieendoprothese kann ein Retropatellarersatz implantiert werden.
Auch die Technik hat sich verbessert: Je nach Art der Endoprothese können zur Implantation Roboterassistenzsysteme oder konventionelle Ausrichtungssysteme genutzt werden. Hinsichtlich klinischer und funktioneller Ergebnisse und unerwünschter Ereignisse bestehen keine Unterschiede.
*Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie
S3-Leitlinie „Prävention und Therapie der Gonarthrose“; AWMF-Register-Nr. 187-050;
www.awmf.org