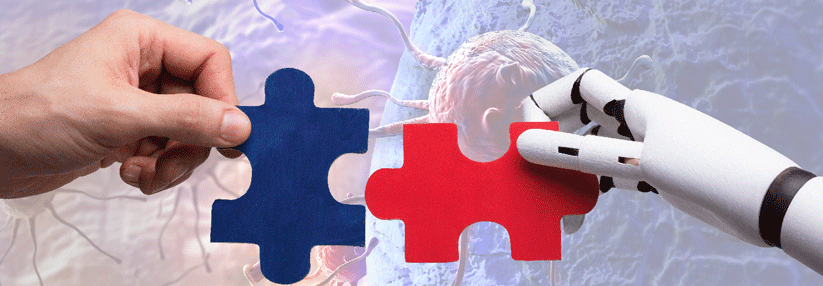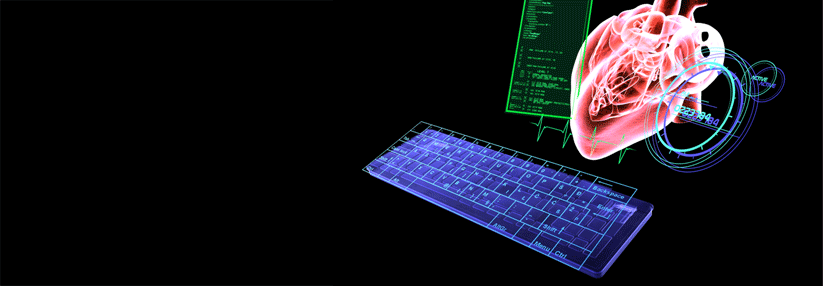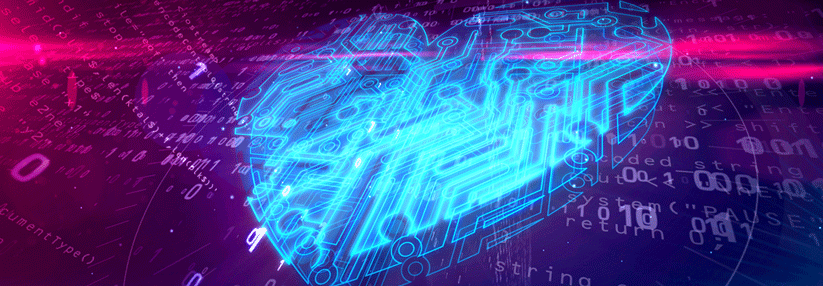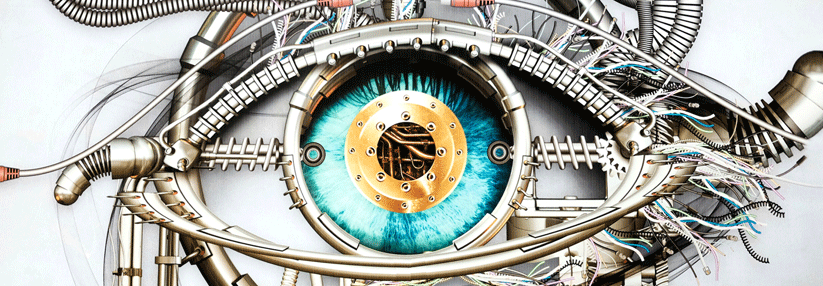Wann sind Algorithmen die besseren Ärzte?
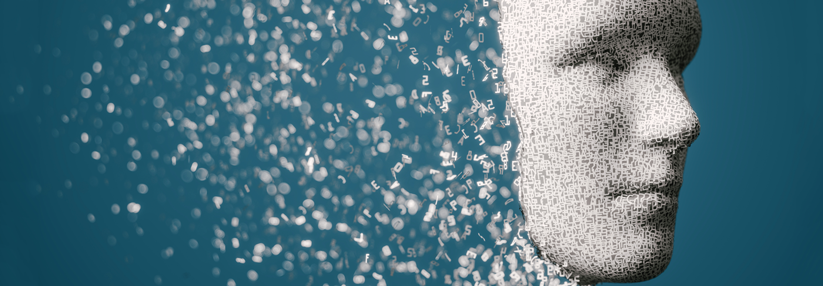 Rechnen kann Künstliche Intelligenz deutlich schneller als Menschen. Doch selbstständiges Denken und Fühlen sind nicht möglich.
© iStock/imaginima
Rechnen kann Künstliche Intelligenz deutlich schneller als Menschen. Doch selbstständiges Denken und Fühlen sind nicht möglich.
© iStock/imaginima
Auf der DiaTec finden auch Themen Platz, die nicht unmittelbar mit Diabetestechnologie zu tun haben. In diesem Jahr versuchte der Philosoph und Jesuit Professor Dr. Michael Bordt, Institut für Philosophie und Leadership an der Hochschule für Philosophie, München, Antworten auf eine wichtige Frage zu finden: Wer wird in Zukunft der besser Arzt sein – ein Mensch oder ein Algorithmus?
Doch wie definieren wir Künstliche Intelligenz (KI) und wozu ist sie tatsächlich in der Lage? Eine ältere Definition aus den 1950er-Jahren schlägt vor, anstelle von Künstlicher Intelligenz besser von Künftiger Informatik oder auch „Machine Learning“ zu sprechen. Spätere Erkenntnisse sprechen davon, dass KI immer nur schwache KI sein wird. Eine starke KI kann es prinzipiell nicht geben, denn Computerprogramme sind formale Systeme, die entweder festgelegten Regeln folgen oder Muster erkennen. Beides erfolgt algorithmisch, also gemäß einer Lösungsvorschrift in endlichen Schritten.
Überlegenheit ist eine Frage der Kriterien
Diese Algorithmen entsprechen der Syntax einer Sprache. Denken und die Bedeutung von Wörtern zu verstehen, geht weit über die Syntax hinaus, denn zusätzlich zur Syntax braucht es eine Semantik – wir müssen also die Bedeutung der Sprache verstehen.
Künstlich, aber nicht intelligent
Maschineller Therapie fehlt die Empathie
Doch was ist ein guter Arzt? Prof. Bordt zitierte aus dem Buch „AI Superpowers“ von Dr. Kai Fu Lee: „Patienten möchten nicht von einer Maschine behandelt werden, die wie eine Black Box gefüllt ist mit medizinischem Wissen und sich dann so ausdrückt: ‚Sie haben ein Lymphom im vierten Stadium und eine Sterbewahrscheinlichkeit von 70 Prozent innerhalb von fünf Jahren‘. Stattdessen wünschen sich Patienten Menschlichkeit und Empathie, gepaart mit medizinischem Wissen und Erfahrung.“ Authentizität und die Fähigkeit zu Selbstwahrnehmung sind für den Experten die Voraussetzung dazu, Empathie empfinden zu können. Es geht dabei nicht um Mitleid, sondern um Mitgefühl, denn während Mitleid zur Handlungsunfähigkeit führt, ist Mitgefühl die Fähigkeit, den anderen zu verstehen und zu begleiten. Wer sich selbst wahrnimmt, kann auch professionell auf die Patienten und Patientinnen eingehen. Je deutlicher man sich selbst wahrnimmt, desto sensibler spürt man andere Menschen. Übrigens: Wer sich selbst wahrnimmt, schützt sich damit auch vor Stress und Burnout. Denn wer für Stress anfällig ist, spürt sich selbst nicht mehr. Prof. Bordt sieht die Medizin in einer Krise, denn trotz außergewöhnlicher Fortschritte in Kunst, Wissenschaft und Medizin werden Patienten zu oft im Stich gelassen. Seiner Überzeugung nach besteht daher die größte Chance von KI darin, die wertvolle Verbindung und das Vertrauen – auch „die menschliche Note“ genannt – zwischen Patienten und Ärzten wiederherzustellen, weil sie Zeit schafft für Wesentliches. Wenn der Arzt sich während der Behandlung voll und ganz seinem Patienten widmen kann und nicht mit Bürokratie und Administration beschäftigt ist, können wir zurückkehren zu einer menschlichen Medizin.Chancen der Künstlichen Intelligenz sehen
Ein schönes Beispiel kommt aus der Schweiz: Die Online-Teleklinik Medgate bringt im Mittel 13 Minuten für das Arzt-Patienten-Gespräch auf, diese Zeit hat in Deutschland kein Arzt. In diesem Sinne ist KI als Chance für die Entwicklung der Medizin und nicht als Gefahr zu sehen. Prof. Bordt schloss seinen Vortrag mit fünf Prioritäten, die aus Sicht der Jesuiten ein gelungenes und erfülltes Leben ausmachen (in der genannten Reihenfolge):- Genügend Schlaf
- Gesundheit
- Self-Awareness und Meditation
- In Beziehungen leben
- Arbeit
Kongressbericht: Diatec 2020