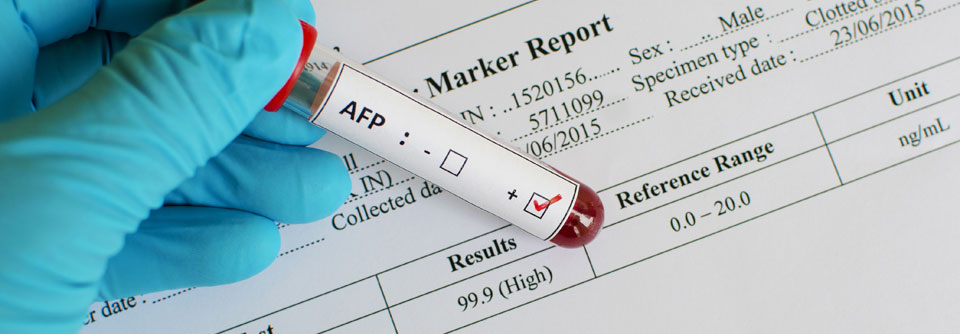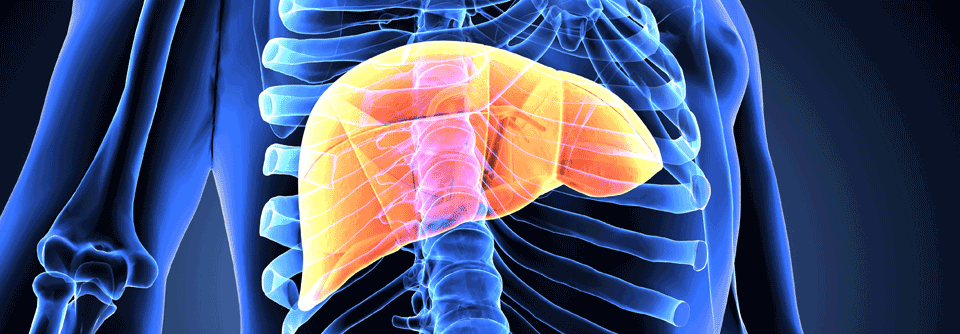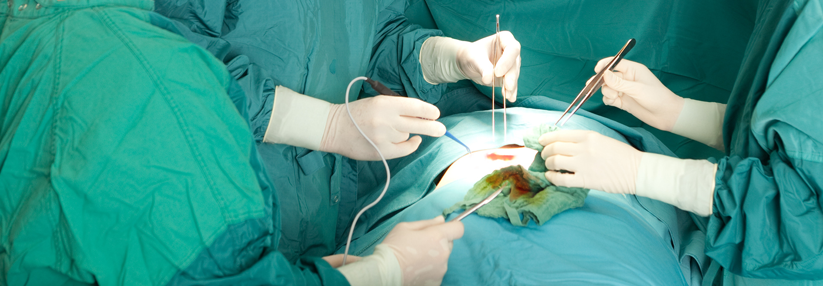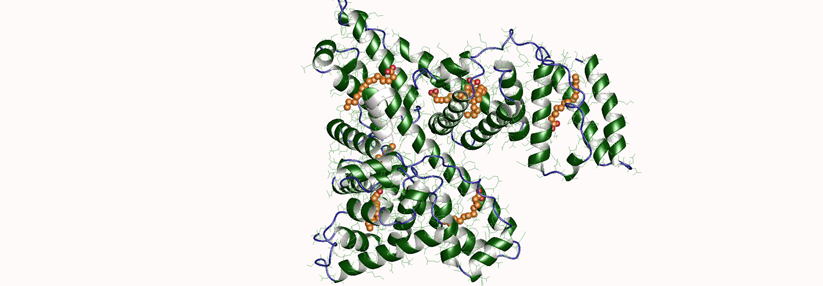Systemtherapie beim HCC auf dem Prüfstand Was tun bei HCC mit gleichzeitiger Leberfunktionsstörung?
 Die am weitesten verbreitete Klassifizierung zur Bestimmung des Grades der Leberfunktionseinschränkung bei HCC ist der Child-Pugh-Score.
© meeboonstudio - stock.adobe.com
Die am weitesten verbreitete Klassifizierung zur Bestimmung des Grades der Leberfunktionseinschränkung bei HCC ist der Child-Pugh-Score.
© meeboonstudio - stock.adobe.com
Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung hat die Mehrheit der Patientinnen und Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC) bereits eine Leberzirrhose entwickelt. Wie ihre Krankheit weiter verläuft, hängt nicht nur von den Merkmalen des Tumors ab, sondern auch vom Ausmaß der Leberfunktionsstörung sowie den damit verbundenen Komplikationen.
Beim fortgeschrittenen HCC gilt die Systemtherapie als Behandlungsoption der ersten Wahl. Klare Empfehlungen in westlichen Leitlinien gibt es allerdings nur für Personen mit erhaltener Leberfunktion. Dies liegt vor allem daran, dass eine fortgeschrittene Leberfunktionsstörung in vielen klinischen Studien ein Ausschlusskriterium ist und daher keine ausreichende Evidenz in dieser Patientenpopulation vorliegt.
In einer aktuellen Übersichtsarbeit hat ein Team um Dr. Matthias Pinter von der Medical University of Vienna,Wien, Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Systemtherapien bei Menschen mit HCC und fortgeschrittener Leberfunktionsstörung zusammengetragen. Auf Basis dieser Informationen schlagen die Autoren außerdem einen Therapiealgorithmus vor, der die Entscheidungsfindung in der klinischen Praxis erleichtern soll.
Die am weitesten verbreitete Klassifizierung zur Bestimmung des Grades der Leberfunktionseinschränkung bei HCC ist der Child-Pugh-Score. Er berücksichtigt Parameter für die Syntheseleistung (z. B. Albumin, Blutgerinnung) und die Exkretion (z. B. Bilirubin) der Leber ebenso wie Dekompensationsereignisse (z. B. Aszites, hepatische Enzephalopathie).
Patientinnen und Patienten mit kompensierter Leberzirrhose fallen in der Regel in die Child-Pugh-Klasse A, während die Klasse C auf eine Lebererkrankung im Endstadium hindeutet. Dazwischen liegt die Child-Pugh-Klasse B, die aufgrund der hohen Heterogenität weniger eindeutig ist. Zu ihr können sowohl Personen mit kompensierter Lebererkrankung als auch solche mit stabiler oder instabiler Dekompensation – vom kontrollierten Aszites bis hin zum akut-auf-chronischen Leberversagen (ACLF) – zählen. Das mediane Gesamtüberleben reicht von weniger als drei Monaten in der Child-Pugh-Klasse C bis hin zu über 16 Monaten in der Klasse A.
Fast ein Jahrzehnt lang dominierte der Tyrosinkinaseinhibitor (TKI) Sorafenib die systemische Therapielandschaft beim fortgeschrittenen HCC. Mittlerweile gelten Immun-checkpointinhibitoren (ICI) als Goldstandard. Der Vorteil: Sie werden nicht über die Leber verstoffwechselt, sodass ihre Verträglichkeit nicht durch Einbußen in der Leberfunktion beeinträchtigt wird. Neben TKI und ICI stehen Inhibitoren des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF) bzw. dessen Rezeptor für die Systemtherapie zur Verfügung. Alle Therapieoptionen sind mit spezifischen Risiken behaftet, welche bei der Therapieentscheidung in jedem Einzelfall berücksichtigt werden sollten.
Die Entscheidung über die Einleitung einer systemischen Therapie bei Personen mit hepatozellulärem Karzinom und Child-Pugh-Klasse B sei immer eine individuelle Entscheidung und sollte von einem multidisziplinären Team getroffen werden, schreiben die Autoren der Übersichtsarbeit.
Generell sind ihrer Ansicht nach Patientinnen und Patienten mit Child-Pugh-Klasse B7, bei denen kein Aszites vorliegt, Kandidaten für eine Systemtherapie. Aber auch mit Aszites oder Child-Pugh B8 kann eine systemische Therapie erwogen werden. Gute Aussichten auf eine Besserung bestehen vor allem dann, wenn die Leberfunktionsstörung sowohl auf eine hohe Tumorlast als auch auf eine zugrunde liegende behandelbare Lebererkrankung zurückzuführen ist. Falls keines der beiden Kriterien zutrifft, ist eine bestmögliche supportive Behandlung in der Regel die bessere Entscheidung. Gleiches gilt für Menschen mit einem Child-Pugh-Score B ≥ 9, einer instabilen Dekompensation oder ACLF. Auch bei einem ECOG-PS*-Wert von 2 kann von einer so schlechten Prognose ausgegangen werden, dass die Betroffenen vermutlich nicht von einer Systemtherapie profitieren.
* Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
Quelle: Pinter M et al. Gut 2025; DOI: 10.1136/gutjnl-2025-334928