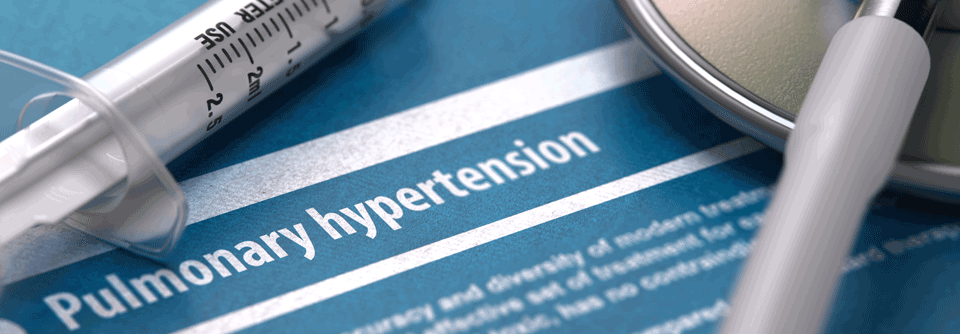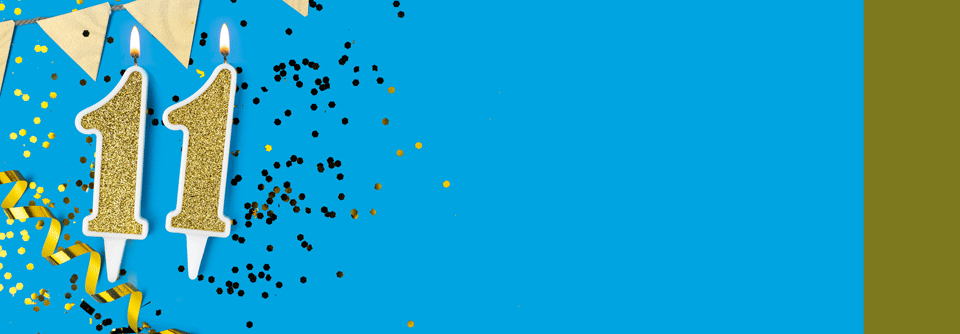Leitlinie Wenn Kinder Krebs überleben: Handlungsempfehlungen für die Nachsorge
 Ein Ziel der Nachsorge bei Krebsleiden im jungen Alter ist die frühzeitige Detektion von Zweitneoplasien.
© pingpao - stock.adobe.com
Ein Ziel der Nachsorge bei Krebsleiden im jungen Alter ist die frühzeitige Detektion von Zweitneoplasien.
© pingpao - stock.adobe.com
Ein Ziel der Nachsorge bei Krebsleiden im jungen Alter ist die frühzeitige Detektion von Zweitneoplasien. Ein besonders hohes Risiko besteht nach Stammzelltransplantation oder CAR*-T-Zelltherapie, so das Autorenteam der aktuellen Leitlinie der GPOH** und weiterer Fachgesellschaften. Frauen nach thorakaler Strahlenbehandlung soll ein intensiviertes Brustkrebsscreening angeboten werden.
Kardiale Spätfolgen nach Jahrzehnten möglich
Auch kardiale Erkrankungen treten nach überstandener Neoplasie im Kindes- oder Jugendalter vermehrt auf. Sie gehen mit einer erhöhten Mortalität einher und können sich sogar Jahrzehnte nach Therapieende noch manifestieren. Sicherheitshalber raten die Autorinnen und Autoren der aktualisierten S2k-Leitlinie zu einer lebenslangen Nachsorge.
Eine weitere häufige Spätfolge sind Schilddrüsenerkrankungen, vor allem die Unterfunktion. Deshalb sollte man nach stattgehabter Radiotherapie des Halses regelmäßig TSH und fT4 kontrollieren. Zudem bilden sich vermehrt benigne und maligne Knoten.
Weiterhin ist mit einer verminderten Knochendichte zu rechnen. Nach kranialer oder kraniospinaler Bestrahlung bzw. Glukokortikoidbehandlung ist eine DXA-Untersuchung indiziert – jeweils zu Beginn der Langzeitnachsorge und im Alter von 25 Jahren. Ein primärer Hyperparathyreoidismus manifestiert sich oft erst Jahrzehnte nach zervikaler Radiotherapie. Umso wichtiger ist eine Überwachung der Kalziumwerte.
Der Pubertätsstatus lässt sich anhand des Tanner-Stadiums ermitteln. Bei Jungen sind zusätzlich Hodenvolumen und Spermarche zu erfassen, bei Mädchen Menarche und Zyklusanamnese. Eine Pubertätsinduktion bzw. Hormonersatztherapie kommt in Betracht, wenn im Alter von 14 Jahren noch keine entsprechenden Anzeichen vorliegen, ebenso bei fehlender Menarche/Spermarche mit 16 Jahren oder stagnierender Entwicklung.
Wer im Kindesalter ein Malignom hatte, trägt zeitlebens ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege. Zum Erhalt der Langzeitfunktion sollten glomeruläre und tubuläre Störungen frühzeitig diagnostiziert und nach Möglichkeit behandelt werden.
Außerdem ist auf pulmonale Langzeitfolgen zu achten (Kurzatmigkeit bei Anstrengung, chronischer Husten). Besonders gefährdet sind Menschen nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation, Strahlentherapie mit pulmonaler Exposition und Operationen an Lunge oder Brustwand.
Gehör und Gleichgewicht regelmäßig checken
Viele Krebstherapien in Kindheit und Jugend bergen ein erhöhtes Risiko für langfristig fortschreitende Hör- und Gleichgewichtsstörungen bzw. Tinnitus. Deshalb sind regelmäßige audiologische Kontrollen angezeigt.
Auch mit dermatologischen Spätfolgen ist zu rechnen, deshalb sollten sich Betroffene einmal jährlich einem hautärztlichen Screening unterziehen und auf konsequenten UV-Schutz (LSF ≥ 50) achten.
Fertilitätsstörungen treten bei etwa einem Drittel der Langzeitüberlebenden auf, nach Konditionierungstherapie vor Stammzelltransplantation sind mehr als zwei Drittel betroffen. Fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen sollten möglichst schon vor Beginn der Tumortherapie durchgeführt werden, danach ist mit einem verringerten Erfolg zu rechnen. Bei erhaltener Ovarial- bzw. Hodenfunktion können Verfahren der assistierten Reproduktion eingesetzt werden. Schwangerschaften verlaufen meist unkompliziert. Besonderheiten bestehen im Falle einer Anthrazyklintherapie und Beckenbestrahlung.
Eine neuropsychologische Nachsorge soll wegen der vielfältigen Risikofaktoren nach Neoplasie mit ZNS-Beteiligung lebenslang durchgeführt werden. So lassen sich Spätfolgen erkennen und geeignete Interventionen einleiten, optimal sind Fünf-Jahres-Intervalle.
Von großer Bedeutung sind zahnärztliche Kontrollen: Veränderungen wie Hypodontie, verkürzte Zahnwurzeln und Schmelzdefekte sind bekannte Langzeitfolgen nach Tumortherapie im Kindesalter. Besonders gefährdet sind Patientinnen und Patienten, die bereits als Säuglinge oder Kleinkinder eine antineoplastische Behandlung erhalten haben.
Auch eine engmaschige Untersuchung von Mundschleimhaut, Zunge und Speicheldrüsen ist unerlässlich, vor allem wenn im betroffenen Gebiet eine Radiotherapie erfolgte. Dabei ist auf Veränderungen (Graft-versus-Host-Erkrankung), Infektionen und Sekundärneoplasien oder Rezidive zu achten.
* chimeric antigen receptor
** Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie
S2k-Leitlinie „Langzeit-Nachsorge bei krebskranken Kindern und Jugendlichen – Vermeiden, Erkennen und Behandeln von Spätfolgen“; AWMF-Register-Nr. 025-003;
www.awmf.org