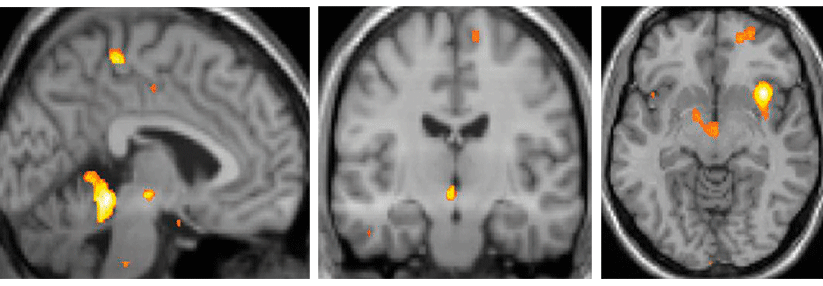Zwangsstörung: Häusliche Expositionstherapie digital begleiten
 PatientInnen bewerten die videogestützte Expositionstherapie meist positiv. (Agenturfoto)
© Andrey Popov – stock.adobe.com
PatientInnen bewerten die videogestützte Expositionstherapie meist positiv. (Agenturfoto)
© Andrey Popov – stock.adobe.com
Im Rahmen stationärer Therapien lässt sich die Exposition im häuslichen Umfeld wegen des hohen Aufwands bislang kaum durchführen. Aber auch im niedergelassenen Bereich setzen weniger als 10 % der Therapeuten diese Empfehlung um, bemängelte Dr. Simone Pfeuffer von der Psychosomatik & Psychotherapie der Schön-Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee. Der Einsatz von medienbasierten Methoden könnte das ändern, hofft sie. Dazu reicht ein portables System mit Smartphone und Stativ, sodass die Behandler die Exposition gegenüber der auslösenden Situation live am Bildschirm verfolgen und therapeutisch begleiten können.
Dr. Pfeuffer berichtete über eine in Prien durchgeführte Studie mit einem solchen System. Seit 2015 haben 88 Jugendliche und Erwachsene eine Exposition zu Hause unter der Experimentalbedingung durchgeführt, 33 eine unbegleitete Heim-Exposition als Kontrollen. Die Teilnehmer bewerteten die videogestützte Expositionstherapie überwiegend positiv. 80 % fanden die Benutzerfreundlichkeit gut und gaben an, dass es fast so sei, als ob der Therapeut im Raum sei.
Leitlinienempfehlung lässt sich besser umsetzen
Für verschiedene Aspekte gaben die Patienten der Experimentalgruppe signifikant bessere Wertungen ab als jene mit unbetreuter Heimexposition:
- Tiefe des Inhalts
- allgemeine Beurteilung der Sitzung
- therapeutische Aufgaben
- therapeutische Beziehung
- therapeutische Allianz insgesamt.
„Die Technik ermöglicht eine bessere Umsetzung der Leitlinienempfehlung“, ist Dr. Pfeuffer überzeugt. Sie stellt sich vor, dass die videogestützte häusliche Exposition standardmäßig bereits ein bis zwei Mal im Rahmen des stationären Aufenthalts durchgeführt und danach als Rückfallprophylaxe über ein bis zwei Wochen ambulant fortgeführt wird. Zur weiteren Nachsorge ließe sich das Prinzip dann mithilfe von webbasierten Angeboten wie dem Mind Doc über fünf bis zehn weitere Expositionen fortsetzen.
Eine Alternative könnte die virtuelle Exposition mit der zwangsauslösenden Situation sein – ebenfalls gestützt durch Therapeuten, erläuterte Dr. Lara Marie Bücker von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Zu den möglichen Vorteilen der Exposition mit Reaktionsmanagement in virtueller Realität (VR-ERM) gehören eine niedrigere Ablehnungsrate, größere Kontrollierbarkeit, eine leichtere Organisation und ein geringerer Zeitaufwand.
Bei Angststörungen gelang es schon, einen großen Effekt der VR zu belegen. Zu Zwangsstörungen gibt es bislang aber noch wenig Daten.
Zudem ist unklar, ob die Ergebnisse auf den Alltag übertragen werden können und ob die vorwiegend visuellen Stimuli ohne Gerüche oder Berühren ausreichen. Ein weiteres Problem: Die VR-Brille alleine stellt eventuell schon eine Exposition dar, beispielsweise bei Wasch- oder Kontaminationszwängen.
Acht weibliche Patienten mit diesen Zwangsstörungen und Ekel als primärer Emotion schloss Dr. Bücker in eine Pilotstudie zur Durchführbarkeit von VR-ERM ein. Virtuell mussten die Teilnehmerinnen eine öffentliche Toilettenanlage mit stark verschmutzen Waschbereichen und WCs betreten. Es sprachen allerdings nur zwei Patientinnen mit einer deutlichen Reduktion der Zwangssymptome an, zwei mussten die Exposition vorzeitig abbrechen. Teilweise blieb die virtuelle Umgebung für die Frauen eine künstliche, für andere war die Umgebung zwar sehr real, aber das Fehlen der Gerüche relativierte das Erleben.
Nutzen der virtuellen Realität wird noch geprüft
Immerhin kam es nicht zu unerwünschten Effekten wie Übelkeit oder okulomotorischen Störungen, betonte Dr. Bücker. Über Puls und Hautleitfähigkeit ließ sich die Anspannung in der ersten Expositionssitzung messen, allerdings war diese Anspannung nicht direkt mit der Emotion Ekel assoziiert. Die Studie läuft weiter mit einem Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe.
Eine weitere VR-Umgebung soll bei Patienten mit Kontrollzwängen untersucht werden. Insgesamt scheint der virtuelle Weg aber noch ein längerer als die per Smartphone-Videokonferenz vom Therapeuten unterstützte Exposition mit Reaktionsmanagement.
Kongressbericht: DGPPN-Kongress 2020 – digital (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde)