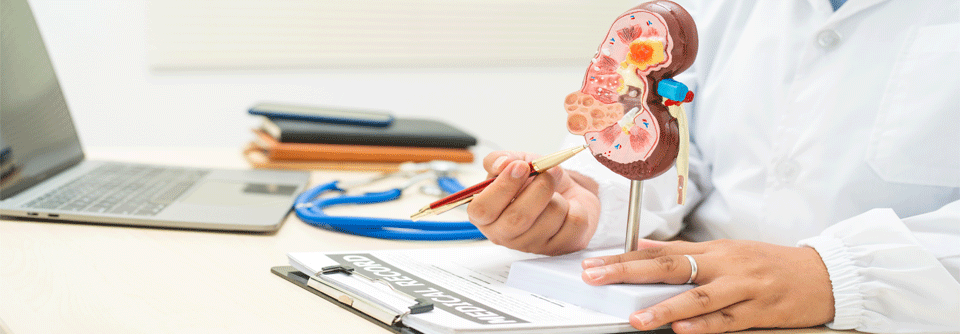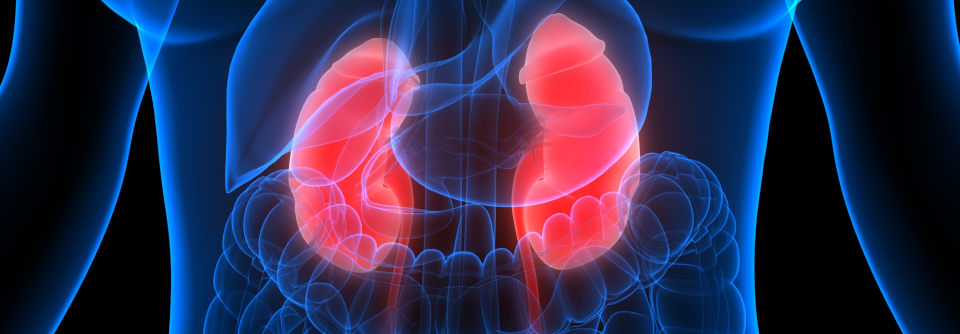
Zwischen Goldstandard und Praxisalltag Zwei Leitlinien zur chronischen Nierenerkrankung
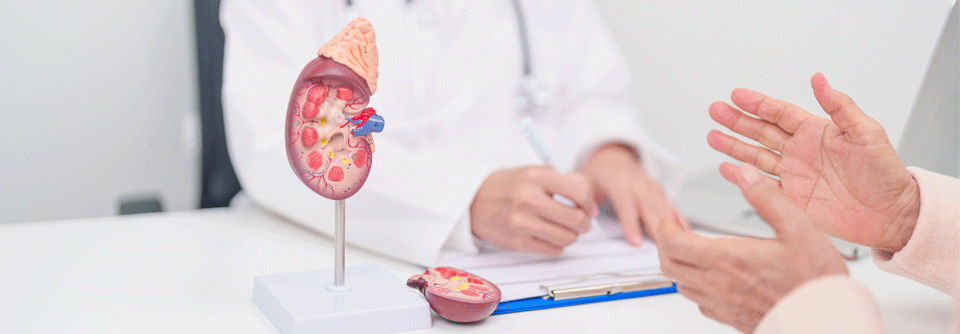 Die optimale Versorgung von Patient:innen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem wissenschaftlich Wünschenswerten und dem im Versorgungsalltag praktisch Machbaren.
© Jo Panuwat D - stock.adobe.com
Die optimale Versorgung von Patient:innen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem wissenschaftlich Wünschenswerten und dem im Versorgungsalltag praktisch Machbaren.
© Jo Panuwat D - stock.adobe.com
Die optimale Versorgung von Patient:innen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem wissenschaftlich Wünschenswerten und dem im Versorgungsalltag praktisch Machbaren. Besonders deutlich wird dies beim Vergleich der global ausgerichteten Leitlinie der KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) „KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease“ mit der speziell für die deutsche Hausarztpraxis konzipierten S3-Leitlinie „Versorgung von Patient:innen mit chronischer, nicht-nierenersatztherapiepflichtiger Nierenkrankheit in der Hausarztpraxis“ der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin). Während KDIGO den internationalen, evidenzbasierten Goldstandard definiert, versucht die DEGAM-Leitlinie, diesen in die Realität der deutschen hausärztlichen Versorgung zu übersetzen, die von Budgetierung und spezifischen Rahmenbedingungen geprägt ist. Ein seinem Vortrag „Management der CKD bei Erwachsenen: Wie deckungsgleich sind KDIGO-CKD-LL und DEGAM S3 LL zum Management der CKD in der Hausarztpraxis?“ beleuchtete Prof. Dr. Martin Kuhlmann, (Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin) auf der 17. Jahrestagung der DGfN im Oktober 2025 in Berlin die entscheidenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten und zeigte dabei zentrale Herausforderungen der Versorgung in Deutschland auf.
Zwei Leitlinien, zwei Welten: Zielgruppe und Philosophie
Ein fundamentaler Unterschied zwischen den beiden Leitlinien liegt bereits in ihrer grundlegenden Philosophie und Zielgruppe. Die KDIGO-Leitlinie versteht sich als umfassender, globaler Standard, der sich an alle im Gesundheitswesen tätigen Personen richtet – von Nephrolog:innen bis zum Pflegepersonal. Sie repräsentiert den aktuellen Stand der internationalen Forschung. Die DEGAM-Leitlinie hingegen ist explizit für die hausärztliche Versorgung in Deutschland konzipiert und richtet sich bewusst nicht an Nephrologinnen und Nephrologen. Ihr Ziel ist es, die Progression der CKD zu verlangsamen, die Kooperation zwischen den Sektoren zu verbessern und, ganz entscheidend, eine Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Hausarztpraxis zu vermeiden.
Diagnostik: Wo der Unterschied am größten ist
Diese unterschiedliche Ausrichtung führt zu signifikanten Abweichungen, die sich am deutlichsten im Bereich der Diagnostik zeigen.
1. eGFR-Bestimmung:
- KDIGO empfiehlt für eine präzisere Einschätzung der Nierenfunktion, insbesondere bei unplausiblen Werten, die zusätzliche Messung von Cystatin C und die Verwendung der kombinierten eGFR-Formel (eGFRcr-cys).
- DEGAM verzichtet auf diese Empfehlung. Prof. Kuhlmann begründet dies im Vortrag mit der Praxisrealität: Cystatin C sei mit Kosten von ca. 9,70 Euro im Vergleich zu 40 Cent für Kreatinin schlicht zu teuer und in der hausärztlichen Praxis „unüblich“.
2. Albuminurie-Screening (UACR):
Hier liegt laut Prof. Kuhlmann der größte Unterschied:
- KDIGO empfiehlt klar, bei Risikopatienten immer sowohl die eGFR als auch die Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin (UACR) zu bestimmen, um das Risiko vollständig zu erfassen.
- DEGAM geht einen Schritt zurück und empfiehlt die UACR-Messung erst, wenn die eGFR bereits unter 60 ml/min/1,73 m² gefallen ist. Der Grund ist, wie Kuhlmann schildert, auch hier wieder ein systemisches Problem: Die Kosten von 3,80 Euro pro UACR-Test belasten das Laborbudget der Hausarztpraxen. Eine Überschreitung dieses Budgets führt zum Verlust von Bonuszahlungen, was einen starken negativen Anreiz für ein breites Screening schafft.
Diese pragmatische, aber aus nephrologischer Sicht auch problematische Zurückhaltung setzt sich in den Therapieempfehlungen fort. Beim Blutdruckmanagement gibt KDIGO ein ambitioniertes Ziel von unter 120 mmHg systolisch vor, sofern der Patient dies toleriert. Die DEGAM hingegen definiert lediglich den Behandlungsbeginn ab einem Wert von über 140/90 mmHg und überlässt die Festlegung des Zielwerts einer individuellen Entscheidung.
Ähnlich verhält es sich mit modernen Medikamentenklassen:
- SGLT2-Hemmer: Von KDIGO als First-Line-Therapie empfohlen, wird der Einsatz in der DEGAM-Leitlinie auf Patienten mit einer Albuminurie ≥300 mg/g oder einer eGFR <45 ml/min/1,73 m² beschränkt .
- Statintherapie: KDIGO empfiehlt Statine breit für CKD-Patienten über 50 Jahre. DEGAM begrenzt die Empfehlung auf Patienten bis 75 Jahre mit hohem kardiovaskulärem Risiko und sieht für Ältere keine ausreichende Evidenz zur Primärprävention .
Auch beim Monitoring bestehen deutliche Unterschiede. Die DEGAM-Leitlinie reduziert bewusst die von KDIGO empfohlene Frequenz der Kontrolluntersuchungen deutlich, um eine "Überversorgung" zu vermeiden.
Wo die DEGAM-Leitlinie eigene Akzente setzt
Dennoch ist die DEGAM-Leitlinie weit mehr als nur eine "abgespeckte" Version des internationalen Standards. Sie setzt eigene, für den hausärztlichen Alltag wertvolle Akzente.
So empfiehlt sie eine einmalige Nierensonographie bei Erstdiagnose, um strukturelle Ursachen zu erkennen, und integriert die spezifischen Impfempfehlungen der STIKO für CKD-Patient:innen – ein Detail, das in der globalen KDIGO-Leitlinie fehlt. Zudem wird die Nutzung der Kidney Failure Risk Equation (KFRE) zur Abschätzung des Progressionsrisikos empfohlen. Prof. Kuhlmann merkte hierzu jedoch kritisch an, dass dieser Score primär das Risiko für eine terminale Dialysepflichtigkeit abbildet und nicht die allgemeine CKD-Progression, was zu einer problematischen Unterschätzung des tatsächlichen Risikos führen kann.
Bessere Früherkennung möglich durch Ausnahmeziffern?
Trotz der Unterschiede teilen beide Leitlinien eine gemeinsame Basis: die Definition der CKD, die Bedeutung von Lebensstiländerungen und die klare Überweisungsgrenze zum Nephrologen bei einer eGFR <30 ml/min/1,73 m².
Der Vergleich macht deutlich: Die KDIGO-Leitlinie 2024 definiert den internationalen State-of-the-Art der Nierenmedizin. Die DEGAM-Leitlinie übersetzt diesen in den pragmatischen, budgetierten Alltag der deutschen Hausarztpraxis. Der Vortrag von Prof. Kuhlmann zeigt jedoch auch, dass die größte Hürde für eine bessere CKD-Früherkennung in Deutschland weniger im Wissen der Ärzte als vielmehr in den finanziellen Rahmenbedingungen des Systems liegt. Die Hoffnung ruht auf Initiativen, wie der von der DGfN angestrebten Schaffung von Ausnahmeziffern, um die diagnostische Lücke bei der UACR-Bestimmung zu schließen und die Versorgung der Patienten nachhaltig zu verbessern.
Quelle: Nierenarzt/Nierenärztin 6/25