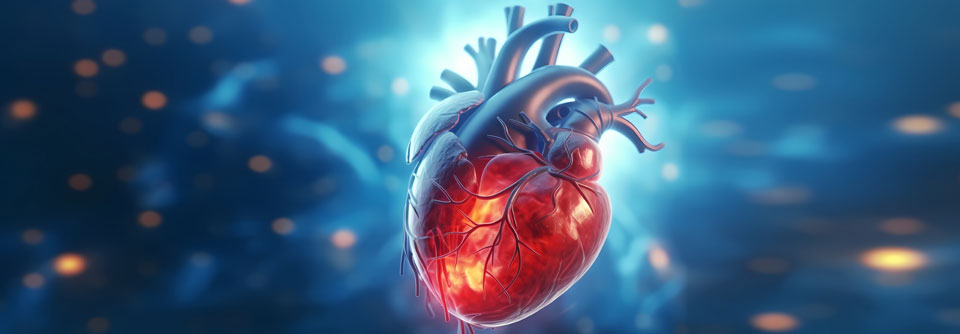Hereditäre Kardiomyopathien im Fokus Bei Herzinsuffizienz die Genetik im Blick haben
 Bei der Suche nach der Ursache einer Herzinsuffizienz sollte man genetisch bedingte Kardiomyopathien nicht vergessen.
© fizkes - stock.adobe.com
Bei der Suche nach der Ursache einer Herzinsuffizienz sollte man genetisch bedingte Kardiomyopathien nicht vergessen.
© fizkes - stock.adobe.com
Die Kardiomyopathie bezeichnet eine Störung im Myokard, ohne dass eine KHK, eine Hypertonie, ein Vitium oder eine angeborene Herzerkrankung vorliegt. Einen großen Anteil machen dabei hereditäre Kardiomyopathien aus, schreibt Prof. Dr. Brenda Gerull, Universitätsklinikum Würzburg. Viele Betroffene haben anfangs keine Symptome, sodass die Diagnose erst spät im Stadium der Dekompensation gestellt wird. Neben einer Herzinsuffizienz mit oder ohne Beeinträchtigung der Ejektionsfraktion können Synkopen oder Palpitationen auftreten, die lange nicht wahrgenommen werden. Aber auch ein plötzlicher Herzstillstand ist möglich. In der Leitlinie der ESC* aus dem Jahr 2023 werden fünf verschiedene Phänotypen von Kardiomyopathien aufgeführt:
1.Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM). Hier zeigt sich eine verdickte linke Ventrikelwand, die sich nicht allein durch abnorme Belastungen erklärt. Es gibt obstruktive und nichtobstruktive Formen mit bzw. ohne Verengung des Ausflusstrakts. Die Ejektionsfraktion ist erhalten (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF).
2.Dilatative Kardiomyopathie (DCM). Bei ihr sieht man eine Ausweitung des linken Ventrikels, ebenfalls ohne vorausgegangene abnorme Belastungen. Die Ejektionsfraktion ist reduziert (HFrEF) oder mittelgradig eingeschränkt (HFmrEF).
3.Nichtdilatative linksventrikuläre Kardiomyopathie (NDLVC). Sie wurde als neue Definition eingeführt mit den Kennzeichen einer nicht-ischämischen Narbe oder fibrolipomatösen Gewebes in der Wand des linken Ventrikels. Zudem liegt eine Einschränkung der Ejektionsfraktion vor (HFrEF oder HFmrEF).
4.Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC). Bei dieser Form dominiert die Ausweitung und/oder Dysfunktion des rechten Ventrikels, die Ejektionsfraktion weist in der Regel Minderungen auf (HFrEF oder HFmrEF).
5.Restriktive Kardiomyopathie (RCM). Merkmal dieser seltenen Form ist eine gestörte Dehnbarkeit der Ventrikel bei normaler Wanddicke. Davon betroffen ist insbesondere der linke Ventrikel. Das diastolische und systolische Volumen kann normal oder reduziert sein, die Ejektionsfraktion bleibt erhalten (HFpEF).
Als Verdachtsmomente für eine hereditäre Kardiomyopathie nennt die Kollegin beispielsweise kardiologische Symptome (Schwindel, Übelkeit, Kaltschweißigkeit) bei noch relativ jungen Patientinnen und Patienten (zwischen 10 und 50 Jahre). Auch frühe plötzliche Todesfälle in der Familie oder Angehörige mit früher Herzschwäche sollten einen hellhörig werden lassen. Dann gilt es, eine systematische Diagnostik anzustreben, empfiehlt Prof. Gerull. Dazu gehören EKG, Langzeit-EKG, Labortests und bildgebende Verfahren.
Basisuntersuchung ist das transthorakale Echo
In die letztgenannte Kategorie fällt als Basisuntersuchung die transthorakale Echokardiografie, darüber hinaus die kardiale MRT und die CT sowie nuklearmedizinische Verfahren. Mithilfe der Bildgebung kann man morphologische und funktionale Veränderungen erkennen und dadurch den Phänotyp bestimmen. Mit der kontrastverstärkten Kardio-MRT lassen sich beispielsweise Veränderungen im Gewebe erkennen, die auf eine NDLVC hinweisen.
Im Ruhe-EKG deuten u. a. atrioventrikuläre Blöcke, ventrikuläre Prä-Exzitationsmuster und hohe bzw. niedrige QRS-Potenziale auf eine Kardiomyopathie hin. Mit dem Langzeit-EKG dokumentiert man Vorhofflimmern, ventrikuläre Rhythmusstörungen und Reizleitungsstörungen. Der Befund spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Einschätzung der Prognose, d. h. die Gefahr eines plötzlichen Herztods, geht.
Ein wichtiges diagnostisches Tool ist zudem die Stammbaumanalyse, die mindestens drei Generationen umfassen sollte. Erfasst werden Alter und Begleitumstände bei plötzlichen Todesfällen sowie dokumentierte Herzerkrankungen von Familienangehörigen. Bei gesicherter hereditärer Kardiomyopathie ist eine genetische Testung zu erwägen. Auf jeden Fall sollte man biologisch verwandte Familienmitglieder kardiologisch untersuchen. Ein unauffälliger Befund schließt aber nicht aus, dass die Erkrankung sich erst später zeigt. Ausprägung und Altersabhängigkeit können innerhalb einer Familie stark variieren, betont Prof. Gerull.
Ein Gentest könnte hilfreich sein, um das Risiko für Erkrankte und Verwandte einzuordnen. Angehörige ohne krankheitsverursachende Genvariante bräuchten dann nicht regelmäßig kardiologisch überwacht werden, Trägerinnen und Träger dagegen besonders engmaschig. Wichtig zu wissen: Die Behandelnden müssen die Patientin bzw. den Patienten vorher aufklären und dies auch dokumentieren. Die Betroffenen müssen schriftlich einwilligen. Ihnen muss klar sein, was der Befund für sie bedeutet und dass es auch ein Recht auf Nichtwissen gibt.
Noch strenger ist das Gendiagnostikgesetz bei sogenannten prädiktiven Tests bei (noch) nicht erkrankten Angehörigen. Eine solche Diagnostik erfordert eine humangenetische Beratung vor und nach dem Test, die nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden darf.
*European Society of Cardiology
Quelle: Gerull B. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 831-844; doi: 10.1055/a-2304-7182