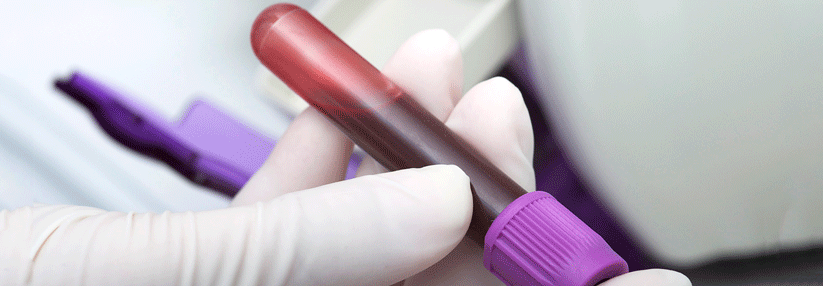
Epikardiales Fett als neuer kardiovaskulärer Risikoindikator
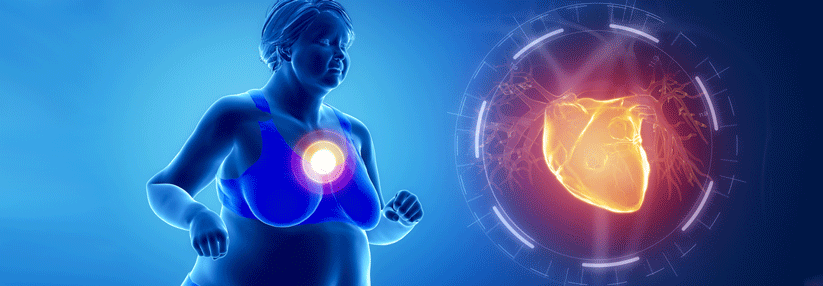 Ob man epikardiales Fettgewebe therapeutisch beeinflussen kann, ist unklar.
© iStock/janulla
Ob man epikardiales Fettgewebe therapeutisch beeinflussen kann, ist unklar.
© iStock/janulla
Epikardiales Fett (EKF) dient sowohl als Energiespeicher als auch als mechanischer Puffer für das Herz, erklärte Dr. Alexander van Rosendael vom Weill Cornell Medical College in New York. Es weist eine Reihe von Besonderheiten auf, die es von anderen viszeralen Fettdepots unterscheidet. So besteht eine enge Verbindung zum Myokard ohne trennende Faszien, was die direkte „Kommunikation“ zwischen Muskel- und Fettgewebe erlaubt. Außerdem teilen sich beide dieselbe Mikrozirkulation. Bis hierhin handelt es sich um erwünschte Effekte.
Epikardiales Fett kann aber auch proinflammatorische Zytokine ausschütten, wenn Körpergewicht, viszerales und damit auch epikardiales Fettvolumen steigen. Daraus folgen pathologische Prozesse wie Entzündung und Fibrose des Myokards, Zunahme von oxidativem Stress und Vorhofremodeling. Es konnte gezeigt werden – nicht nur im Tierversuch, sondern an Patienten –, dass das Risiko, Vorhofflimmern (AF) zu bekommen, mit der Menge des EKF korreliert. Adipöse haben bekanntlich ohnehin ein erhöhtes AF-Risiko, doch vermehrtes Herzfett erhöht das Risiko noch stärker als ein hoher Body-Mass-Index oder der Taillenumfang.
Die Bildgebung birgt diverse Tücken
Wie lässt sich epikardiales Fett messen? Prinzipiell eignen sich Ultraschall, CT und MRT, wobei jedes Verfahren seine eigenen Stärken und Schwächen mitbringt – das CT erzeugt Strahlenbelastung, das MRT dauert relativ lange, der Ultraschall erlaubt keine exakte Volumen- und Oberflächenvermessung. Dr. van Rosendael hofft, dass es bald Verfahren gibt, die eine vollautomatisierte Quantifizierung des Fettvolumens per CT oder MRT erlauben. Das würde viel Zeit sparen.
Epikardiales Fett sezerniert nicht nur per se ein anderes Potpourri an Mediatoren als andere Fettgewebe, erklärte Privatdozent Dr. Mohamed Marwan vom Universitätsklinikum Erlangen. Es enthält zudem ein spezifisches Kontingent von Immunzellen, das sich verändert, wenn sich eine KHK entwickelt. Je mehr Fett das Herz umgibt, desto mehr Hochrisikoplaques finden sich in den Koronarien. Patienten mit akutem Koronarsyndrom haben im Schnitt mehr epikardiales Fett als die mit stabiler Angina.
In einer finnischen Studie korrelierte die Menge epikardialen Fetts mit BMI und Taillenumfang ab dem 12. Lebensjahr – es scheint, dass eine lange Übergewichts-Exposition die Ablagerung von EKF fördert. Bis hierher lautet das Fazit also: Epikardiales Fett ist ein neuer Risikoindikator, wahrscheinlich sogar Risikofaktor für die Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen.
Eine Reihe von Fragen bleibt aber offen, etwa die, ob sich das pathologische Fett bevorzugt an Prädilektionsstellen für Koronarplaques ablagert. Wo liegt die Grenze zum Pathologischen? Entscheidet die Quantität oder die Qualität des Fettgewebes über das Risiko? Und natürlich: Wie lässt sich epikardiales Fett therapeutisch beeinflussen und welchen Effekt hat das aufs Risiko?
Mit den Kilos schmilzt das Fett
Was diese letzte Frage angeht, sind schon vor zehn Jahren erste Studienergebnisse erschienen. 20 schwer adipöse Patienten (BMI 45 kg/m2) unterzogen sich sechs Monate lang einer strengen Diät, bei der sie fast 20 % ihres Körpergewichts verloren. Parallel dazu nahmen natürlich BMI und Taillenumfang ab, noch mehr aber das epikardiale Fett (knapp 35 %), berichtete der Kollege. Sollte sich das Fettpolster am Herzen also wirklich als lohnendes Therapieziel erweisen, wäre Gewichtskontrolle eine effektive Maßnahme, es zu reduzieren.
Quelle: ESC (European Society of Cardiology) Congress 2018






