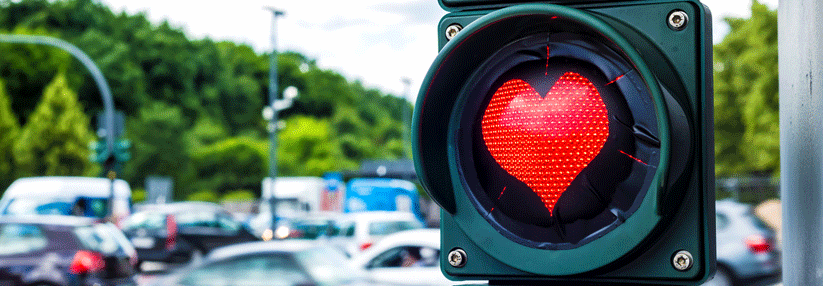Fahrtauglichkeit von Senioren: Schon leichte kognitive Defizite erfordern Prüfung
 Es muss nicht gleich die manifeste Demenz sein, die ein Fahrverbot erfordert.
© Pixabay
Es muss nicht gleich die manifeste Demenz sein, die ein Fahrverbot erfordert.
© Pixabay
Dunkelheit, stark befahrene Straßen oder plötzliche Gefahrensituationen bringen schon geistig fitte Senioren an ihre Grenzen, denn sie müssen schnell und fehlerlos reagieren können. Allerdings nimmt die Leistung des Gehirns im Alter ab. Kommen dann noch kognitive Defizite infolge von ZNS-Erkrankungen oder durch Einnahme von Medikamenten hinzu, wirkt sich dies erheblich auf die Fahrtauglichkeit der Oldies aus.
Geistige, motorische und Sinnesleistung überprüfen
Weil Behörden hierzulande ältere Autofahrer bislang nicht regelmäßig überprüfen, müssen u.a. Hausärzte in die Bresche springen. „Aufklären und evtl. Fahrverbote aussprechen“, so beschreibt Professor Dr. Klaus Schmidtke von der Rehaklinik Klausenbach in Nordrach ihre Aufgabe. Sonst drohen unter Umständen juristische Konsequenzen.
Im Gegensatz zu Demenzerkrankungen mit deutlichen kognitiven Einbußen kann es bei leichten Einschränkungen sehr schwer werden, zu entscheiden, wie fit ältere Semester im Straßenverkehr sind. Hier müssen Kollegen individuell über die geistige, motorische und die Sinnesleistung urteilen.
In Sachen Fahrtauglichkeit gilt es drei wesentliche Fragen zu klären:
- Welche Erkrankung liegt vor?
- Welche kognitiven Defizite bestehen aktuell?
- Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch auf die Fahrtauglichkeit?
Im Rahmen nachlassender Leistungen kommt es oft zu Neugedächtnisstörungen, die beispielsweise dazu führen, dass sich Betroffene neue Fahrstrecken schlechter merken. Die Fahrtauglichkeit an sich ist kaum betroffen, weshalb sie ruhig auch noch aufs Pedal treten dürfen, meint Prof. Schmidtke. Allerdings können die Fähigkeiten schon in wenigen Monaten rasch abnehmen. Darauf müssen Sie Patienten und deren Angehörige hinweisen. Ebenso sollten Sie den Status quo kontinuierlich überprüfen und die Diagnose innerhalb von 3–6 Monaten sichern. Als wesentlich dafür sieht Prof. Schmidtke die Fremdanamnese sowie weiterführende klinische und neuropsychologische Tests an (s. Kasten). Kommt man dann zu dem Schluss, ein Fahrverbot auszusprechen, ist die Arbeit noch nicht getan.
Unbequeme Fragen an Angehörige stellen
- Fährt der Vater noch sicher und orientiert?
- Baut er vermehrt Unfälle oder verursacht Blechschäden?
- Würden Sie Ihre Kinder noch zu ihm ins Auto setzen?
- Erklären Sie den Betroffenen unmissverständlich, dass ab sofort und lebenslang ein totales Fahrverbot besteht.
- Besprechen Sie das auch mit den Angehörigen.
- Dokumentieren Sie all das unbedingt in Akte und Arztbrief. Eine unzureichende Information oder Dokumentation stellt einen gravierenden Aufklärungsfehler dar, warnt Prof. Schmidtke.
Quelle: Schmidtke K. Fortschr Neurol Psychiatr 2018; 86: 37-42