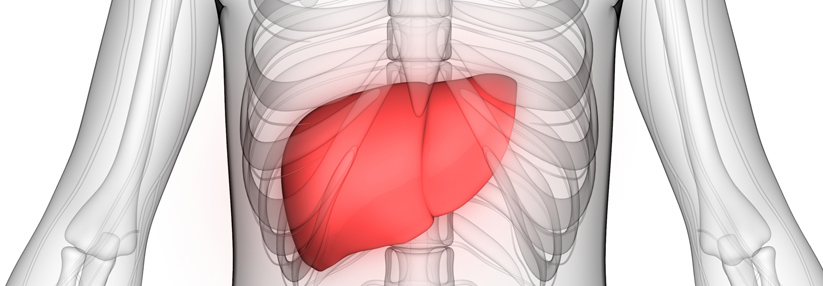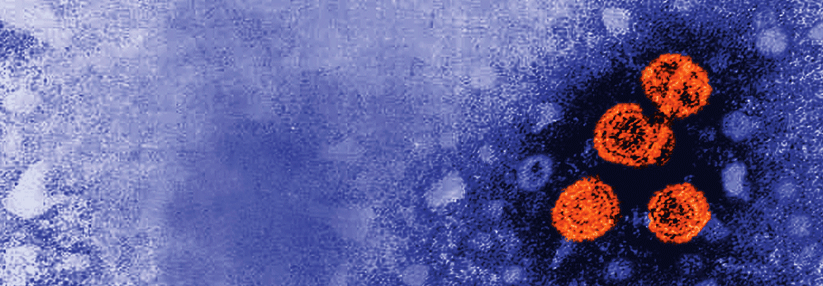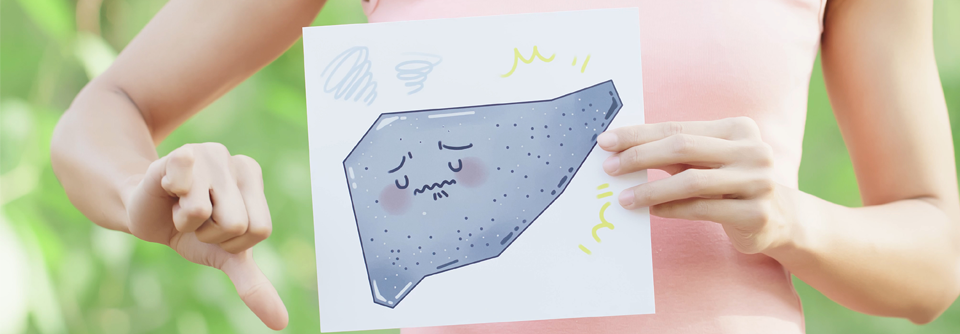
Wenn die Leber plötzlich versagt Gerinnungsstörung und hepatische Enzephalopathie kennzeichnen das Krankheitsbild
 Das akute Leberversagen betrifft hierzulande geschätzt 200 bis 500 Menschen jährlich.
© filins - stock.adobe.com
Das akute Leberversagen betrifft hierzulande geschätzt 200 bis 500 Menschen jährlich.
© filins - stock.adobe.com
So ganz aus heiterem Himmel bricht die Leberfunktion nicht zusammen – typischerweise kommt es vorher zu einer akuten Leberschädigung, die mit Symptomen wie Abgeschlagenheit, Juckreiz und Gelbsucht einhergeht. Innerhalb von Stunden bis Wochen entwickelt sich dann eine Koagulopathie sowie hepatische Enzephalopathie und damit ein akutes Leberversagen (ALV). Man unterscheidet drei Verlaufsformen (siehe Kasten).
Entscheidend für die Diagnose ist, dass keine chronische Organschädigung vorliegt, z. B. in Form einer chronischen Virushepatitis, betonen Dr. Dr. Natascha Röhlen und Prof. Dr. Robert Thimme vom Universitätsklinikum Freiburg. Es gilt also das ALV von einem akut-auf-chronischen Leberversagen abzugrenzen – letzteres tritt häufiger auf und unterscheidet sich hinsichtlich Therapie und Prognose. Das ALV gilt als seltenes Krankheitsbild. Schätzungen zufolge betrifft es jedes Jahr ca. 200 bis 500 Menschen in Deutschland, die Mortalität beträgt hierzulande 47 %.
Medikamente, Drogen und Pilze als potenzielle Trigger
Während Hepatitis B früher als Hauptauslöser des ALV galt, stehen heutzutage in westlichen Industrienationen medikamentös-toxische Ursachen im Vordergrund. Insbesondere NSAR, Antibiotika und Paracetamol, aber auch Drogen, Pilze und Supplemente können ein ALV auslösen. Als seltenere Trigger nennt das Autorenduo vaskuläre, infektiöse, immunologische und metabolische Ursachen. Auch eine schwangerschaftsassoziierte Leberschädigung ist möglich.
Die meisten Betroffenen präsentieren sich bereits vor dem ALV mit unspezifischen Symptomen. In der Anamnese sind die Vorgeschichte und Risikofaktoren für eine Lebererkrankung (z. B. Alkohol- und Drogenmissbrauch) ebenso zu erheben wie der zeitliche Verlauf. Gleiches gilt für alle eingenommenen verschreibungspflichtigen und naturheilkundlichen Mittel und Supplemente.
Bei der klinischen Untersuchung sollte man darauf achten, ob bereits Zeichen einer hepatischen Enzephalopathie vorliegen – falls ja, gibt dies Anlass, sofort ein Lebertransplantationszentrum zu kontaktieren. Denn das Auftreten einer hepatischen Enzephalopathie geht gerade bei subakuten Verläufen mit einem sehr hohen Mortalitätsrisiko einher, wenn keine adäquate Therapie erfolgt.
Die Labordiagnostik umfasst u. a. die Bestimmung von Transaminasen, Lebersynthese- und -exkretionsparametern sowie eine Blutgasanalyse. Empfohlen wird zudem eine serologische Untersuchung auf Virushepatitiden und andere virale Auslöser sowie auf hepatische Autoimmunerkrankungen. Ein Ultraschall des Bauchraums einschließlich Duplexsono hilft, Tumoren oder vaskuläre Ursachen der Leberschädigung auszuschließen, während eine Biopsie nur in speziellen Situationen erforderlich ist, z. B. um eine Autoimmunhepatitis bei unklarem serologischem Befund zu bestätigen.
Erst Ikterus, dann Ausfall der Leberfunktion
Man unterscheidet beim akuten Leberversagen drei Verlaufsformen – je nachdem, wie rasch sich die Gerinnungsstörung und die hepatische Enzephalopathie nach der Manifestation der Gelbsucht entwickeln:
- hyperakutes Leberversagen (innerhalb von 7 Tagen)
- akutes Leberversagen (innerhalb von 8 bis 28 Tagen)
- subakutes Leberversagen (innerhalb von 5 bis 12 Wochen)
Menschen mit schwerer akuter Leberschädigung sollten generell stationär betreut werden. Liegen bereits Diagnosekriterien für ein ALV vor (hepatische Koagulopathie mit INR* > 1,5 und hepatische Enzephalopathie) und kommt eine Lebertransplantation infrage, sollte man die Person umgehend in ein Transplantationszentrum verlegen. Warnzeichen für eine schlechte Prognose sind Hypoglykämie oder metabolische Azidose – auch diese Menschen gehören in ein Zentrum mit entsprechender Expertise.
Antiinfektives Management von zentraler Bedeutung
Nach Abschluss der Diagnostik und Einschätzung des Schweregrades des ALV geht es um die Prävention, Früherkennung und Therapie von Komplikationen. Als häufigste Todesursachen gelten Sepsis und Multiorganversagen. Daher spielt das antiinfektive Management eine zentrale Rolle. Zudem sollte man einen Volumenmangel ausgleichen.
Eine prophylaktische Gabe von Blutgerinnungsfaktoren empfielt sich nicht. Zusätzlich muss die Entwicklung der Enzephalopathie engmaschig überprüft und auf Zeichen eines Nierenversagens geachtet werden. Nur die Lebertransplantation ist eine direkte kausale Therapie beim akuten Leberversagen. Tools wie der MELD-Score und die King’s-College-Kriterien helfen, Kandidaten ausfindig zu machen.
* International Normalized Ratio
Quelle: Röhlen N, Thimme R. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 371-384; DOI: 10.1055/a-2301-8259