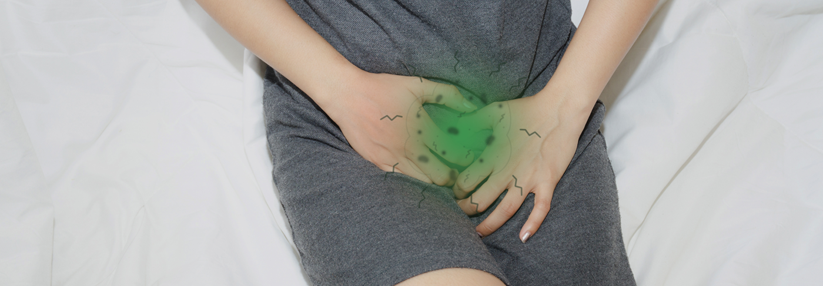
Sexuelle Funktionsstörungen Gestörtes Intimleben neurologisch Kranker nicht einfach als gegeben hinnehmen
 Die Behandlung der sexuellen Funktionsstörung erfolgt einerseits durch die Therapie der neurologischen Grunderkrankung und richtet sich andererseits nach den vorherrschenden Symptomen.
© DisobeyArt – stock.adobe.com
Die Behandlung der sexuellen Funktionsstörung erfolgt einerseits durch die Therapie der neurologischen Grunderkrankung und richtet sich andererseits nach den vorherrschenden Symptomen.
© DisobeyArt – stock.adobe.com
Sex ist medizinisch gesehen eine hochkomplexe Angelegenheit: Neuronale und psychologische Funktionen sind daran ebenso beteiligt wie das vaskuläre und das endokrine System. Es überrascht daher nicht, dass auch neurologische Krankheiten häufig mit sexuellen Problemen einhergehen. Im Klinik- oder Praxisalltag liegt die Schwierigkeit aber nicht nur darin, das sensible Thema anzusprechen, schreiben Dr. Claire Hentzen vom Pariser Universitätsklinikum Hôpital Tenon und Kollegen. Man muss auch herausfinden, welche Aspekte der Sexualität im Detail beeinträchtigt sind. Denn nur so lässt sich nach den möglichen Ursachen fahnden. Besonders häufig klagen die Patienten über einen Verlust der Libido, aber auch ungenügende körperliche Erregbarkeit, Orgasmus- und Ejakulationsstörungen sind verbreitet.
Die Erkrankung des Nervensystems ist zwar die Hauptursache vieler sexueller Funktionsstörungen. Doch spielen auch sekundäre und tertiäre Ursachen eine Rolle. Als Beispiele für sekundäre Faktoren nennen die Autoren u.a. Spastizität, Muskelkrämpfe und Schmerzen. Fatigue geht mit einem deutlichen Libidoverlust einher. Funktionsstörungen der unteren Harnwege und des Darms stehen ebenfalls in engem Zusammenhang mit sexuellen Problemen. Das liegt zum Teil an der geteilten Innervation, aber auch an einer möglichen Inkontinenz, die Intimität angst- oder schambesetzt macht. So zeigte eine Studie aus dem Jahr 2015, dass die erfolgreiche Behandlung von Inkontinenz bei MS-Patientinnen mit Onabotulinumtoxin A deren Zufriedenheit mit dem Sexualleben verbesserte.
Negatives Körperbild kann Probleme verstärken
An Komorbiditäten ist zu denken, etwa vaskuläre Erkrankungen, die häufig mit einer erektilen Dysfunktion einhergehen. Ein Diabetes mellitus kann via endotheliale Störung die Funktion des Schwellkörpergewebes bei Männern und Frauen beeinträchtigen. Angst und Depression – bei neurologischen Patienten häufig anzutreffen – können ebenfalls sexuelle Schwierigkeiten auslösen oder verstärken.
Auf tertiärer Ebene spielen Faktoren wie das Körperbild eine Rolle, das sich durch Erkrankungen häufig zum Negativen verändert. So geben Frauen mit MS sowie Spina bifida in Studien an, sich aufgrund ihrer Krankheit weniger attraktiv zu fühlen. Auch die Rollenverteilung in der Partnerschaft kann sich belastend auf die Intimität auswirken, z.B. wenn der Partner wegen der neurologischen Erkrankung pflegerische Tätigkeiten übernimmt.
Um sexuelle Probleme beurteilen zu können, ist die Frage nach der Medikation der Patienten essenziell. Antidepressiva und Antiepileptika etwa haben bekanntermaßen negative Auswirkungen auf die Sexualität. So vermindern Antidepressiva, insbesondere SSRI, den Sexualtrieb, können die genitale Empfindlichkeit beeinträchtigen sowie Erektions- und Ejakulationsschwierigkeiten verursachen. Auch die Einnahme von Schmerzmitteln, insbesondere von Opiaten, kann die Libido beeinträchtigen sowie zu Erektions- und Orgasmusstörungen führen. Antihypertensiva, Alphablocker und Spasmolytika können ebenfalls die Sexualfunktionen beeinflussen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Beginn der Therapie und dem Auftreten der Probleme kann dabei helfen, zwischen neurogenen und iatrogenen sexuellen Funktionsstörungen zu unterscheiden.
Zeichen der Hypersexualität
Ein spezielles Problem bei neurologischen Erkrankungen ist die Hypersexualität. Sie tritt vor allem bei jüngeren Parkinsonpatienten auf. Zu den klinischen Manifestationen zählen exzessive Masturbation, zwanghafter Pornografiekonsum, eine erhöhte Anzahl von Geschlechtspartnern und Paraphilien. Bei traumatischen Hirnschäden macht sich die Enthemmung häufig durch unangemessene sexuelle Inhalte im Gespräch bemerkbar. Demenzpatienten fallen eventuell durch anzügliche Kommentare, unerwünschte sexuelle Angebote und Masturbation in der Öffentlichkeit auf.
Das Thema Sex anzusprechen, kann eine Herausforderung sein, betonen die Autoren. Nicht nur, dass es Ärzten im Klinik- oder Praxisalltag häufig an Zeit mangelt, diesen Bereich zu beleuchten. Vielen Patienten ist es peinlich, über sexuelle Schwierigkeiten zu reden – erst recht dann, wenn sie von (Ehe-)Partner oder Freundin in die Sprechstunde begleitet werden. Oft ist ihnen gar nicht klar, dass ein Zusammenhang mit ihrer neurologischen Erkrankung bestehen könnte. Der Schlüssel zum Gesprächserfolg ist laut Dr. Hentzen und Kollegen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Mitunter bietet sich als Einstieg die Frage nach Blasen- und Mastdarmproblemen an. Eine vom Arzt ausgehende Aufklärung über sexuelle Funktionsstörungen kann helfen, das Thema zu enttabuisieren.
Um die verschiedenen Dimensionen der Probleme abzudecken, empfiehlt sich, einen validierten Fragebogen wie den Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire (MSISQ) zu nutzen, der auch bei anderen Erkrankungen wie Rückenmarksverletzungen gute Dienste leistet. Darin wird nicht nur nach körperlichen Schwierigkeiten beim Sex gefragt, sondern auch Aspekte wie die gefühlte Attraktivität oder Sorgen in Bezug auf die Partnerschaft werden angesprochen.
Sekundäre Faktoren spezifisch therapieren
Die Behandlung der sexuellen Funktionsstörung erfolgt einerseits durch die Therapie der neurologischen Grunderkrankung und richtet sich andererseits nach den vorherrschenden Symptomen, für die oft eigene Therapieleitlinien vorliegen. Sekundäre Faktoren wie Schmerzen, Inkontinenz oder Spastizität benötigen ggf. spezifische Behandlungsansätze. Besteht der Verdacht, dass psychiatrische Symptome wie Depressionen und Angstzustände der vom Patienten gewünschten Intimität im Wege stehen, sollte man ggf. Fachkollegen hinzuziehen. Gleiches gilt, wenn die Betroffenen unter einem negativen Körperbild leiden oder die Dynamik zwischen ihnen und ihrem Partner eine einschränkende Rolle spielt.
Quelle: Hentzen C et al. Lancet Neurol 2022; 21: 551-562; DOI: 10.1016/S1474-4422(22)00036-9






