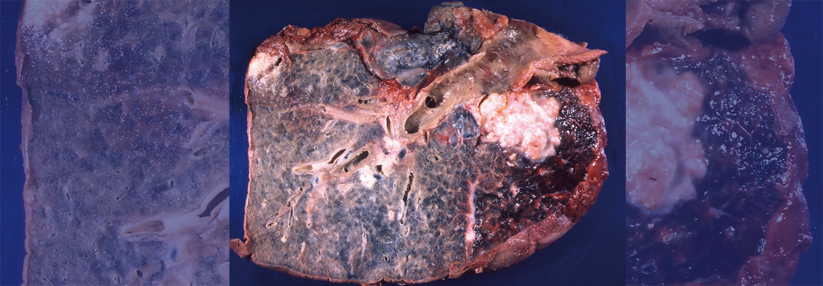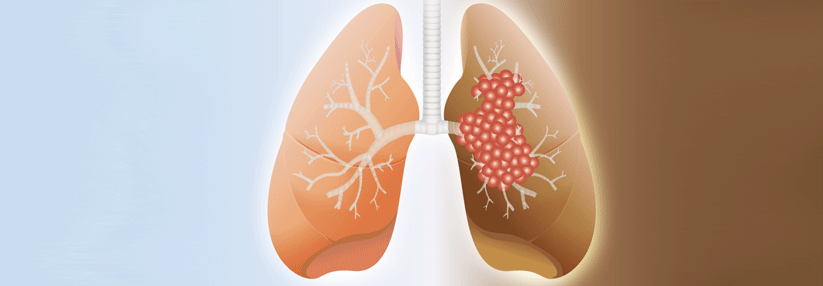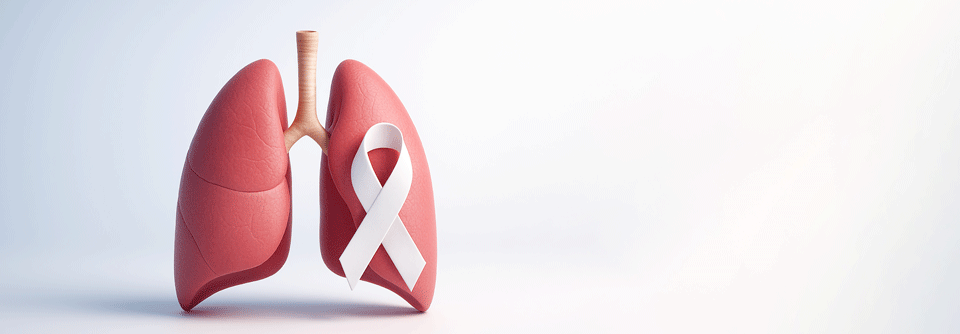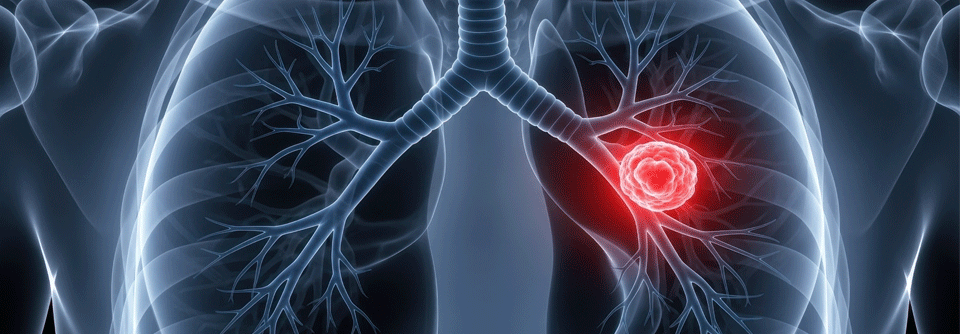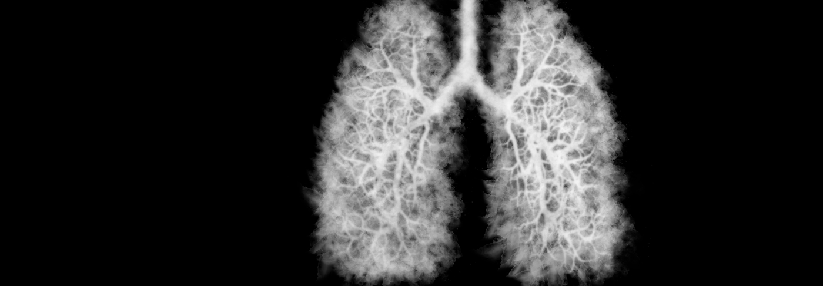
Weniger Risiko – seltener CT Lungenkrebs: Nicht alle Berechtigten brauchen ein jährliches Screening
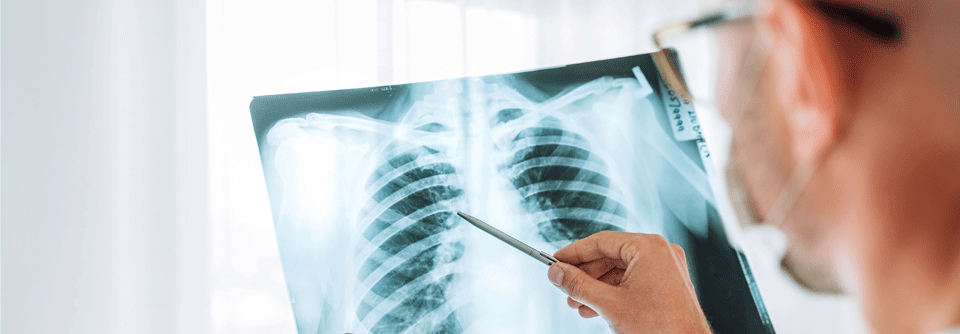 Ein zweijähriges Screening kann bei moderatem Risiko effektiv bleiben und CT-Untersuchungen deutlich reduzieren.
© Soloviova Liudmyla – stock.adobe.com
Ein zweijähriges Screening kann bei moderatem Risiko effektiv bleiben und CT-Untersuchungen deutlich reduzieren.
© Soloviova Liudmyla – stock.adobe.com
Nach den in den USA geltenden USPSTF*-Empfehlungen sollten Personen im Alter von 50–80 Jahren mit hohem Lungenkrebsrisiko jährlich eine Low-Dose-CT erhalten. Ein Team um Koen de Nijs vom Klinikum der Erasmus-Universität Rotterdam betrachtete nun, inwiefern sich die Belastung für Patient:innen und das Gesundheitssystem verringern lässt, wenn man das Screeningintervall an Alter, Geschlecht und Raucherhistorie anpasst.1
Um vorherzusagen, wie sich Änderungen am Früherkennungsschema auf verschiedene Subgruppen auswirken, nutzten die Forschenden drei bestehende Simulationsmodelle. Dabei modellierten sie Outcomes des US-Geburtsjahrgangs 1965 bis zum Jahr 2065 und stratifizierten nach Geschlecht und Tabakexposition im Alter vom 50 Jahren.
Als besonders effizient erwies sich, bei 50- bis 60-Jährigen alle zwei Jahre eine CT durchzuführen und erst danach jährlich zu kontrollieren. Diese Vorgehensweise verhinderte im Vergleich zur jetzigen Früherkennung weiterhin 95,9 % der Todesfälle. Gleichzeitig reduzierte sich die Gesamtmenge der Screeninguntersuchungen um 20,6 %, ebenso sank die Anzahl der CT pro verhindertem Todesfall. Ähnliches ließ sich auch erreichen, wenn man die Früherkennung stattdessen intensiviert, sobald Personen 30 oder 40 Packungsjahre erreicht haben. Die Autor:innen merken allerdings an, dass es sich in der Praxis schwierig gestalten könnte, Letzteres zu überwachen.
In finanzieller Hinsicht bestätigte sich die Kosteneffizienz des jährlichen Screenings gegenüber keinerlei Früherkennung, nicht jedoch gegenüber den risikoadaptierten Protokollen. Obwohl es Unterschiede zwischen Subgruppen gab, starteten die meisten kosteneffizienten Ansätze mit zweijährigen Screeningintervallen und gingen nach 10–15 Jahren oder bei 30–40 Packungsjahren zu jährlichen Untersuchungen über.
Risikoadaptiertes Lungenkrebs-Screening
Die Autor:innen resümieren, dass ein zweijährliches Screening für Berechtigte unter 60 Jahren und/oder mit weniger als 30 Packungsjahren den Nutzen der Früherkennung wahrt. Adaptive Intervalle böten sich insbesondere für Früherkennungsprogramme mit begrenzten Ressourcen an. Dies gilt potenziell ebenso für Einzelpersonen, die weniger häufige Untersuchungen bevorzugen.
Als „nicht überraschend“ ordnete Prof. em. Dr. Carl Martin Tammemägi, Brock University, St. Catherines, die Ergebnisse in einem Kommentar ein.2 Viele Studien hätten positive Resultate zu Screeningintervallen jenseits eines Jahres geliefert, in British Columbia seien zweijährliche Untersuchungen bereits Realität.
Personen mit niedrigerem Lungenkrebsrisiko profitieren aus seiner Sicht hinsichtlich der Mortalität wenig, werden aber durch eine Erweiterung der amerikanischen Screeningkriterien vermehrt eingeschlossen. In diesem Kontext könnte ein risikoadaptiertes Vorgehen mögliche negative Folgen der Früherkennung wie invasive Untersuchungen nach falsch-positiven Befunden vermindern. Auch erhöhe ein zweijähriges Intervall möglicherweise die Teilnahmerate und Adhärenz.
Der Kommentator merkte an, dass eine Alternative darin bestehe, validierte Modelle zur Risikoprädiktion zu verwenden. Auf dieser Grundlage könne man geeignete Personen auf ein zweijähriges Untersuchungsintervall verweisen oder ihnen ganz vom Screening abraten.
* US Preventive Services Task Force
Quellen:
1. De Nijs K et al. JAMA Netw Open 2025; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.23044
2. Tammemägi CM. Jama Netw Open 2025; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.23050