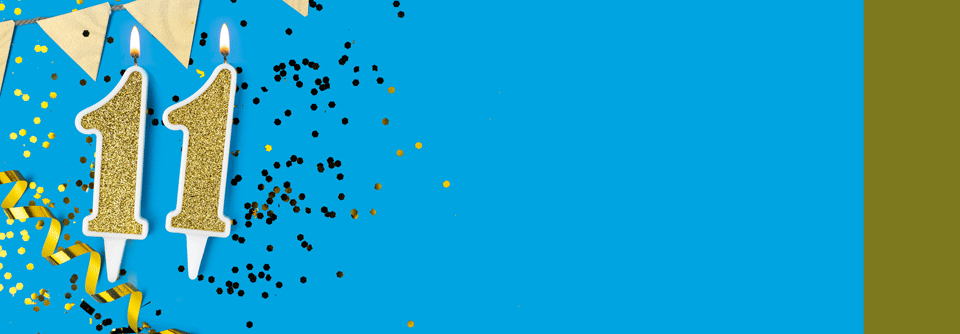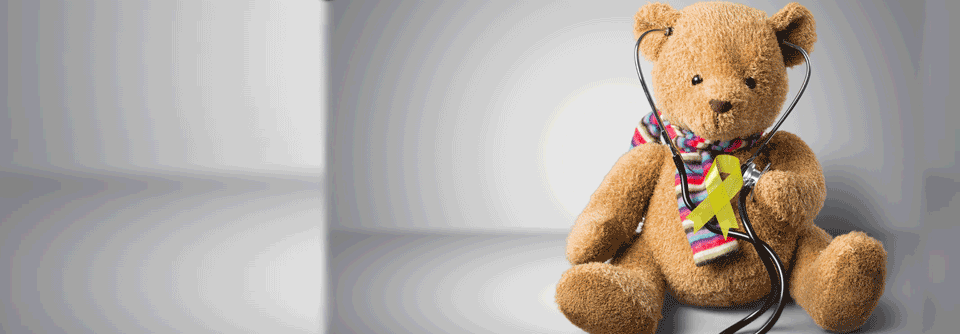Mitten im Leben und unheilbar krank Junge Erwachsene mit palliativer Krebserkrankung haben spezielle Bedürfnisse
 18- bis 39-jährige trifft eine Krebserkrankung in einer Lebensphase voller Umbrüche.
© Kirill Gorliv - stock.adobe.com
18- bis 39-jährige trifft eine Krebserkrankung in einer Lebensphase voller Umbrüche.
© Kirill Gorliv - stock.adobe.com
Junge Krebspatient:innen stehen vor ganz anderen Herausforderungen als ältere Erkrankte, betont Dr. Pia Heußner, Onkologisches Zentrum Oberland im Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Murnau.1 Sie befinden sich in einer Lebensphase, in der die Abhängigkeit der Kindheit und Jugend allmählich der Selbstbestimmung weicht. Vieles ist im Aufbruch: die erste eigene Wohnung, die ersten Schritte ins Berufsleben, sich festigende Partnerschaften – vielleicht sogar die Gründung einer Familie. Gerade in diesem Moment treffe sie die Diagnose „palliativ“ mit voller Wucht, und plötzlich werde die Endlichkeit des eigenen Lebens zur Realität.
In dieser Situation müsse Autonomie oft notgedrungen wieder gegen Abhängigkeit getauscht werden. Anstelle der Freunde, die bislang das soziale Umfeld prägten, rücken nun häufig die Eltern wieder in den Mittelpunkt – sie werden zur neuen Peer Group. „Das bedeutet einen Rückschritt in der Persönlichkeitsentwicklung“, erklärte die Hämatoonkologin und Psychoonkologin. Zwar engagierten sich Freund:innen nach der Diagnose zunächst oft fürsorglich, doch diese Unterstützung bleibe meist nicht von Dauer. „Die Hilfe ist in der Regel nicht nachhaltig“, so die Expertin.
Was aus psychoonkologischer Erfahrung Erkrankten hilft
Für viele junge Krebspatient:innen in palliativer Situation bedeute es eine große Erleichterung zu erfahren, dass das Lebensende nicht zwangsläufig unmittelbar bevorsteht. „Palliativ bedeutet nicht automatisch, dass nur noch wenig Zeit bleibt – es kann durchaus heißen, dass man noch viele Jahre mit der Erkrankung leben kann“, ordnete Dr. Heußner ein. Wenn sie mit Betroffenen über die Möglichkeit einer chronischen Krankheitsphase spreche, falle oft spürbar eine Last von deren Schultern.
Krebs bedeutet oft auch eine finanzielle Krise
Ein Aspekt, der lange nicht genügend im Fokus stand, ist die finanzielle Abhängigkeit, von der die jungen Krebserkrankten häufig betroffen sind. Denn bereits ab der siebten Woche nach der Diagnose wird das volle Gehalt durch Krankengeld ersetzt, welches nach 78 Wochen Krankheit innerhalb von drei Jahren ebenfalls ausläuft. Besonders dramatisch stelle sich die Situation dar bei Betroffenen in der Ausbildung, bei Freiberufler:innen oder jungen Erwachsenen, die bereits Kinder hätten. „Ich habe junge Familien gesehen, die am Abgrund stehen und durch das soziale Netz fallen“, berichtete Dr. Heußner. Für diese Menschen brauche es dringend finanzielle Unterstützungsangebote.
Ein weiteres sensibles, aber bedeutsames Thema sei der Umgang mit Vorsorgeverfügungen und die Frage, wie für die Hinterbliebenen gesorgt werden kann. Um die emotionale Hürde zu überwinden, helfe es oft, den direkten Bezug zur Krebserkrankung zu lösen. Der Hinweis, dass das Leben grundsätzlich unvorhersehbar ist – etwa durch den Vergleich mit einem möglichen tödlichen Autounfall am nächsten Tag – öffne vielen die Tür, sich mit dieser schwierigen, aber wichtigen Thematik auseinanderzusetzen.
„Kein Opfer sein“ – Die Betroffenenperspektive
Abschließend sprach ein 36-jähriger Patient, der unheilbar an einem medullären Schilddrüsenkarzinom erkrankt ist.2 Nach einer lebensbedrohlichen Phase rund um die Diagnose steht der junge Mann heute unter Therapie und konnte in seinen Beruf zurückkehren. Doch vor allem eines machte er unmissverständlich klar: Er lehnt es ab, sich als Opfer zu sehen. „Ich bin immer noch ich – und mehr als mein Krebs.“ Seine neue Rolle im Leben habe er sich erarbeiten müssen – auch im Verhältnis zu seinen Eltern, die ihn beschützen wollten. Heute begegnet er seiner Situation mit Klarheit und sogar einem Hauch von Dankbarkeit: „Ich habe das Gefühl, dass ich erst seit meiner Diagnose wirklich lebe, weil ich jeden Tag bewusst wahrnehme.“
Eine große Stütze in der ersten Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war sein Hund. Das Tier schien die Verletzlichkeit des Referenten intuitiv zu spüren – und forderte dennoch beharrlich die täglichen Spaziergänge ein. Gerade diese liebevolle Konsequenz half ihm, sich in der veränderten Lebensrealität zurechtzufinden und wieder Halt zu gewinnen. Heute widmet sich der junge Mann wieder seinen Hobbys, etwa der Fotografie, und unternimmt lange Spaziergänge mit seiner Frau. Inzwischen ist auch ein zweiter Hund Teil der Familie geworden.
Ein Wunsch bleibt dennoch offen: mehr Unterstützung für seine Frau, die seit seiner Erkrankung viele zusätzliche Aufgaben trägt – auch im Alltag, etwa im Haushalt. „Solche kleinen, aber wichtigen Hilfen sind in unserem System leider nicht vorgesehen“, so der Patient. Ein leiser Appell an Politik und Gesellschaft.
Quellen:
1. Heußner P. Jahrestagung 2025; Vortrag V307
2. Krüger T. Jahrestagung 2025; Vortrag V309