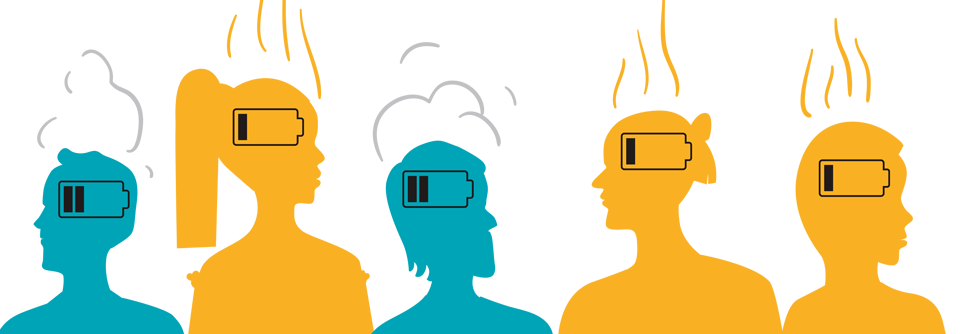Psychoonkologie Welche Interventionen die Resilienz fördern
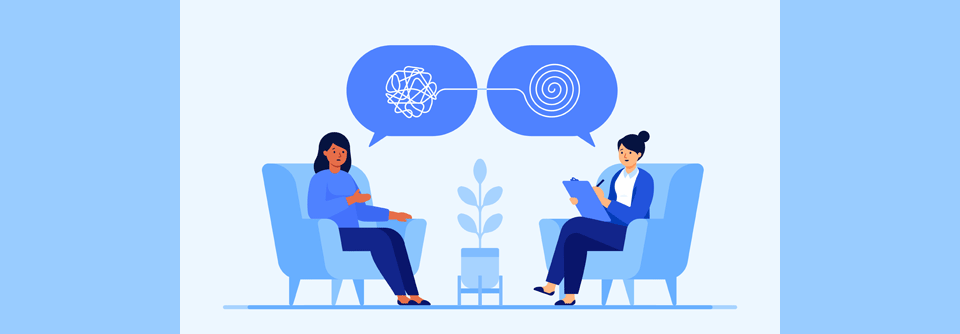 Viele Tumorpatient:innen sind psychisch belastet – gezielte Maßnahmen können ihre Resilienz wirksam stärken.
© Artster – stock.adobe.com
Viele Tumorpatient:innen sind psychisch belastet – gezielte Maßnahmen können ihre Resilienz wirksam stärken.
© Artster – stock.adobe.com
Mit der sogenannten Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) soll die psychische Flexibilität adressiert werden. Letztere stelle die Fähigkeit dar, werteorientiert und bewusst im Hier und Jetzt zu handeln, trotz unangenehmer/hindernder Gedanken und Gefühle, erläuterte PD Dr. Christina Sauer, Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen Frankfurt.1 Sie bezieht auch die Fähigkeit mit ein, das Handeln in Abhängigkeit von der Situation zu ändern oder beizubehalten.
Tumorerkrankung kann Prioritäten verändern
„Psychische Flexibilität und Resilienz sind eng verwandte Konstrukte und protektive Faktoren für unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden“, sagte Dr. Sauer. Betont werden dabei der Einsatz adaptiver Copingstrategien und die Anpassung an den Kontext – der sich zum Beispiel durch eine Krebserkrankung stark verändern kann.
Bei ACT handele es sich um einen transdiagnostischen Ansatz der dritten Welle der Verhaltenstherapie. ACT-Interventionen können über die psychische Flexibilität die Resilienz steigern. Sie helfen unter anderem dabei, sich der Neupriorisierung von Lebenswerten im Rahmen einer Krebserkrankung bewusst zu werden und dies im Alltag auch umzusetzen.
Zur psychischen Flexibilität bzw. zum Behandlungsmodell der ACT gehören:
- Klärung von Lebenswerten: wissen, was zählt
- Akzeptanz, „sich öffnen“: u. a. die aktive Bereitschaft, mit der Krebserkrankung und den damit verbundenen Empfindungen in Kontakt zu sein und das Verhalten so auszurichten, dass es mit tief empfundenen Werten übereinstimmt
- Achtsamkeit: im Hier und Jetzt präsent sein
- Commitment: das zu tun, was wichtig ist, konkrete Handlungen in konkreten Situationen
- Kognitive Defusion („Entstrickung“ vom Inhalt der Gedanken): Fokus auf die Beobachtung des Denkvorgangs
- Selbst als Kontext: die Perspektive eines Beobachters einnehmen
In Studien bzw. einem Umbrella-Review wurde demonstriert, dass die ACT-Kernprozesse mit weniger psychischem Distress bei Krebspatient:innen assoziiert sind. Weiterhin verringerte sich Depressivität, während sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbesserte.
Das kann die traditionelle chinesische Medizin
Qigong kann von allen Patient:innen durchgeführt werden, auch von älteren und gebrechlichen, meinte Dr. Hans Lampe, Universitätsmedizin Rostock. Studien deuten darauf hin, dass sich dadurch die Lebensqualität und kognitive Beeinträchtigung verbessern, ebenso die krebsbedingte Fatigue. Bei der Akupressur sollen sich wiederum Ängste und Anspannungen lösen. Es gebe allerdings kaum Daten.
Quelle:
Lampe H. 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin; Vortrag „Komplementäre Therapie in der Onkologie“
Patient:innen zu mehr Bewegung verhelfen
Bewegungstherapie könne bei Krebserkrankten unter anderem Angst, Fatigue und Depressionen lindern sowie die Lebensqualität und physische Funktion verbessern, berichtete Prof. Dr. Freerk Baumann, Uniklinik Köln.2 Dafür gebe es eine hohe Evidenz. Eine moderate Evidenz liege zu Schlafqualität, kognitiver Funktion, Kardiotoxizität und Knochengesundheit vor.
Personen mit Prostatakrebs sollten beispielsweise zwei bis vier Wochen vor der Operation mit einem Beckenbodentraining beginnen, das mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich erfolgt. Damit lässt sich laut dem Experten postoperativ die Zeit der Harninkontinenz reduzieren. Bewegungsinterventionen rücken auch bei seltenen Tumorerkrankungen vermehrt in den Fokus, z. B. ein präoperatives Koordinationstraining für Patient:innen mit Aderhauttumoren. Neben den klinischen Vorteilen könne man durch Sport- und Bewegungstherapie auch Kosten sparen, so Prof. Baumann.
Derzeit ist eine S3-Leitlinie zur Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen in Arbeit, an der sich 57 Fachgesellschaften beteiligen. Der Referent erwartet für Mai 2026 die Endfassung, die dann konsertiert wird.
Das große Ziel: eine spezifische bewegungs- und ernährungstherapeutische Intervention in die Regelversorgung zu bringen. Prof. Baumann arbeitet hierfür mit anderen Kolleg:innen im G-BA-Innovationsfondprojekt „INTEGRATION“ zusammen.
Quellen:
1. Sauer C. 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin; Vortrag „Akzeptanz- und Commitment-Therapie in der Onkologie“
2. Baumann F. 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin; Vortrag „Sport und Bewegungstherapie in der Onkologie“