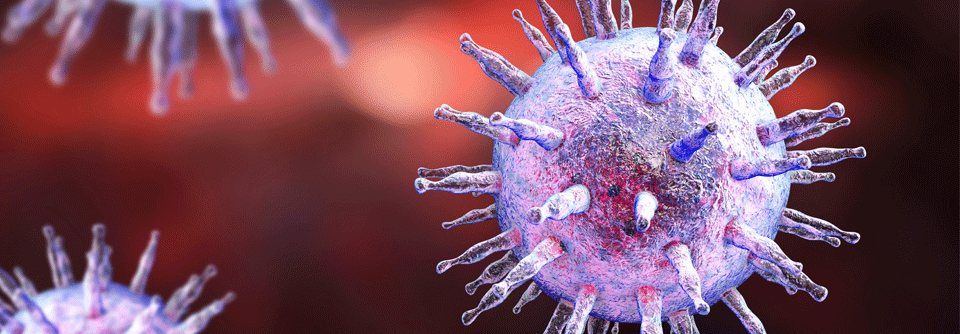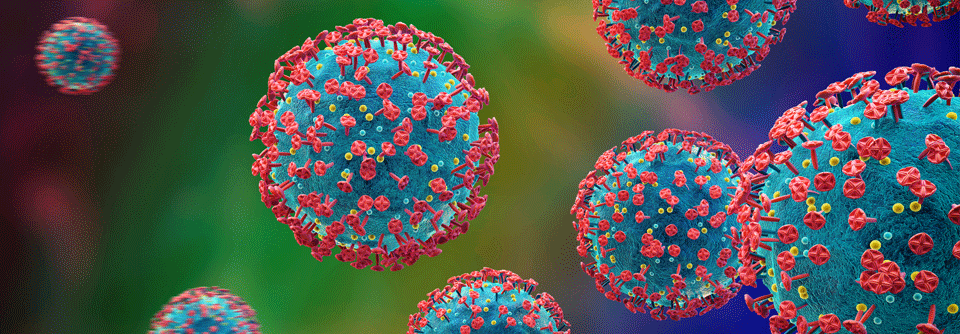
Corona Die Krankheit überstanden, die Folgen nicht
 Bis zu 81 % der hospitalisierten Patienten sind vom Post-COVID-Syndrom betroffen.
© iStock/VioletaStoimenova
Bis zu 81 % der hospitalisierten Patienten sind vom Post-COVID-Syndrom betroffen.
© iStock/VioletaStoimenova
Zu den häufigsten Symptomen des Post-COVID-Syndroms gehört eine länger als vier Wochen über den Beginn der akuten Erkrankung hinaus anhaltende Dyspnoe. Zwischen fünf und 81 % der Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, sind davon betroffen, schreiben David Montani von der Universität Paris-Saclay und seine Kollegen. Von den nicht-hospitalisierten Patienten mit mildem Krankheitsverlauf leiden etwa 14 % an persistierender Dyspnoe. Mit der initialen Schwere von COVID-19 oder der Zahl von Beatmungstagen scheint keine enge Korrelation zu bestehen.
Parenchymschäden, dysfunktionale Atmung, kardiovaskuläre Dysfunktion und muskuläre Dekonditionierung gelten als wichtige Entstehungsmechanismen der anhaltenden Dyspnoe. Bei den meisten Betroffenen bessern sich die Beschwerden mit der Zeit. Es kann aber durchaus bis zu einem Jahr dauern. Nicht selten beruht die Dyspnoe auf dysfunktionaler Atmung, meist einem Hyperventilationssyndrom. Die Pathophysiologie der dysfunktionalen Atmung ist weitgehend unklar. Manche vermuten ein psychologisches Trauma als Ursache, eine zentralnervöse Ursache kann allerdings noch nicht ausgeschlossen werden.
Weniger häufig als Dyspnoe kommt anhaltender Husten im Rahmen eines Post-COVID-Syndroms vor. Bis zu 42 % der Patienten husten länger. Nach einer Hypothese liegt eine Aktivierung vagaler sensorischer Nerven zugrunde, die zu einer Husten-Hypersensitivität führt.
Irreversible Veränderungen vor allem an der Lunge
Zu den irreversiblen radiographischen Veränderungen im Lungenparenchym gehört vor allem die Lungenfibrose, die zusammen mit verschiedenen Läsionen wie interstitiellen Anomalien inklusive Traktionsbronchiektasen auftritt. Derartige Veränderungen findet man bei 13–27 % der Patienten im Langzeitverlauf nach COVID-19. Meist betreffen sie weniger als 25 % des Lungenparenchyms. Patienten, die Riskofaktoren für einen schweren Verlauf aufweisen, ein ARDS entwickelt haben bzw. beatmet werden mussten, sind deutlich häufiger betroffen.
Prinzipiell reversibel sind Milchglastrübungen als Zeichen der akuten Parenchymentzündung. Doch sie wurden auch noch zwölf Monate nach der akuten Erkrankung beobachtet. Fortbestehende Milchglastrübungen können Ausdruck residualer oder autonomer Inflammation sein und die Entstehung von fibrotischen Läsionen begünstigen. Auch wenn sie häufig sind, meist wirken sich die anhaltenden radiologischen Veränderungen insgesamt aber nur geringfügig auf die Lungenfunktion aus.
Als lebensbedrohliche Komplikation von COVID-19 kennt man Lungenembolien. Nach einer aktuellen Metaanalyse liegt deren Inzidenz im Mittel bei 16,5 %. Erklären lässt sich das Auftreten von Lungenembolien möglicherweise mit der pulmonalen endothelialen Dysfunktion, die mit der SARS-CoV-2-Infektion assoziiert ist.
Eine persistierende Gehirnschädigung kann nicht nur als Folge von COVID-19-bedingten Schlaganfällen oder einer Enzephalomyopathie auftreten. Weltweit verdichtet sich derzeit die Evidenz für eine Monate anhaltende kognitive Dysfunktion auch bei Patienten, die keine akuten Neuro-COVID-Manifestationen hatten. Objektiv über kognitive Tests erfasst waren 15–40 % der Post-COVID-Patienten von Defiziten betroffen. Man nimmt an, dass dem Phänomen eine direkte Schädigung des Gehirns durch das Virus, Hypoxie und Entzündung zugrunde liegt.
Psychische Coronafolgen
Nach den respiratorischen Langzeitschäden sind psychische Konsequenzen die zweithäufigste Langzeitfolge von COVID-19. In der COMEBAC-Studie gaben 54 % der Patienten vier Monate nach Hospitalisierung Insomnie an, 31 % Angstsymptome, 22 % depressive Symptome und 14 % posttraumatische Stresssymptome. Dabei muss es nicht unbedingt eine Korrelation zur Krankheitsschwere geben, psychische Symptome können aber mit krankheitsbedingten kognitiven Einbußen zusammenhängen.
Virus schädigt das Herz auf mehrfache Weise
Kardiale Symptome im Rahmen des Post-COVID-Syndroms gehen immer auf eine Schädigung des Herzens in der Akutphase zurück. SARS-CoV-2 kann das kardiovaskuläre System über mehrere Mechanismen schädigen: viraler Befall der Kardiomyozyten, systemische Entzündung, vaskuläre Thrombose, myokardiale Ischämie, Hypoxämie und Stress-Kardiopathie. In der COMEBAC-Studie wurde nach vier Monaten bei 5 % der nicht-intubierten und 18 % der intubierten Patienten eine reduzierte Ejektionsfraktion (LVEF < 50 %) festgestellt. Einige kleinere Studien haben Patienten, deren Infektion drei bis vier Monate zurücklag, mittels Kardio-MRT untersucht. Bei 30–60 % fanden sich Myokardödeme, Nekrosen und Fibrosen; 40 % dieser Anomalien waren nicht ischämiebedingt.
Die Autoren vermuten, dass das Post-COVID-Syndrom durch seine vielfältigen Manifestationen und seine Häufigkeit in den kommenden Monaten zu einer großen Herausforderung für das Gesundheitssystem werden wird. Hinzu kommen weitere Coronafolgen wie Einbußen beim Geruchs- und Geschmacksempfinden und Asthenie bzw. Fatigue. Sie schlagen vor, solche Symptome routinemäßig vier bis sechs Monate nach einer akuten SARS-CoV-2-Infektion mittels Fragebogen zu erfassen. Abhängig von geäußerten Problemen und der Schwere der akuten Erkrankung können dann in einem multidisziplinären Ansatz die Symptome abgeklärt und angegangen werden.
Quelle: Montani D et al. Eur Respir Rev 2022; 31: 210185; DOI: 10.1183/16000617.0185-2021