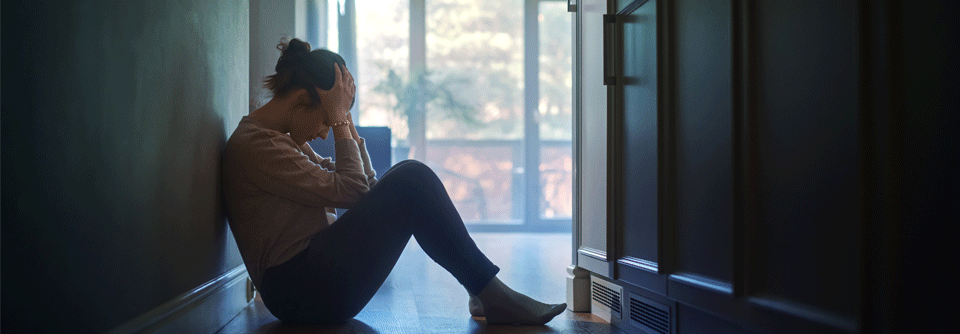Schwerer Unfall, Terroranschlag, häusliche Gewalt: Diagnostik akuter psychologischer Traumata
 Psychologische Traumata stellen eine starke Belastung für die Betroffenen dar.
© llhedgehogll – stock.adobe.com
Psychologische Traumata stellen eine starke Belastung für die Betroffenen dar.
© llhedgehogll – stock.adobe.com
Traumatische Ereignisse wie Unfälle, Gewalt oder sexuelle Übergriffe sind definitionsgemäß extrem belastend oder bedrohend. Auch wenn anderen Personen etwas Schlimmes passiert oder man selbst Zeuge wird, kann es einen tief im Inneren erschüttern. Wie jemand in der Folge reagiert, hängt neben dem objektiven Ereignis vor allem von einer subjektiven Bewertung ab, heißt es in der aktuellen S2k-Leitlinie „Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung“. Mit akut meinen die Autoren einen Zeitraum von bis zu drei Monaten.
Wird das Geschehen als lebensbedrohlich erlebt? Wie hilflos oder ohnmächtig fühlt sich die betroffene Person? Wie groß sind die körperlichen Verletzungen? Um akuten Belastungsstörungen bzw. Stressreaktionen frühestmöglich zu begegnen, raten die Experten, in den ersten Stunden bis Tagen bzw. direkt vor Ort psychologische, psychotherapeutische und psychosoziale Maßnahmen anzubieten.
Schutz- und Risikofaktoren für posttraumatische Reaktionen
- Schutzfaktoren: soziale Unterstützung, hohe Selbstwirksamkeitserwartung, hohes Kohärenzgefühl, Schutz vor zusätzlichen Belastungen
- prätraumatische Risiken: frühere Traumatisierungen und kritische Ereignisse, frühere/aktuelle psychische Erkrankungen, Selbstabwertung, unsichere soziale und/oder finanzielle Lebensbedingungen
- peritraumatische Risiken: Schweres Trauma (z.B. Schädel-Hirn-Trauma), starke erlebte Bedrohung, starke emotionale/psychophysiologische Reaktion
- posttraumatische Risiken für Traumafolgestörungen: depressive Symptome, anhaltende Symptome des akuten Traumas, (fortgesetzte) Dissoziationsneigung, negative Gedanken zum Ereignis/sich selbst/der Welt, kognitive Vermeidung und Vermeidungsverhalten, geringe Selbstwirksamkeitserwartung, anstehende juristische Klärung etc.
Symptome wie Albträume, Schuldgefühle oder Schmerzen
Nicht immer führt ein Trauma unmittelbar zu Beschwerden. Manchmal entwickeln sich Symptome verzögert oder es manifestiert sich eine (chronische) Traumafolgestörung – ohne initiale Belastungsreaktion. Den zeitlichen Verlauf zu erfassen, ist also essenziell. In den meisten Fällen entstehen Symptome jedoch in den ersten Stunden bis Tagen nach dem Ereignis und klingen dann langsam ab, bis sie innerhalb der ersten Woche verschwinden. Mitunter dauert die Abklingphase auch mehrere Wochen. Oftmals erfolgt die psychosoziale Ersteinschätzung im Rahmen der medizinischen Primärversorgung (falls der Betroffene verletzt wurde). Ist dies nicht der Fall, wird so manche psychologische Frühdiagnostik verpasst. Zur Ersteinschätzung gehören psychischer Befund, äußere Sicherheit, verfügbare Ressourcen sowie Risikofaktoren. Wenn möglich, sollten stets die akuten Symptome mit ihrer Intensität erhoben werden. Dabei entscheidet sich auch, ob es gegebenenfalls Spezialisten für Kriseninterventionen oder notfallpsychiatrische Maßnahmen braucht. Beim psychischen Befund stehen die Symptome der akuten Belastungs- oder Stressreaktion im Vordergrund. Darunter fallen unter anderem:- sich aufdrängende, belastende Gedanken an das Geschehen, z.B. Albträume, „Flashbacks“ oder Erinnerungslücken
- intensive psychische Belastungen bei Konfrontationmit Triggerreizen
- Übererregugssymptome wie Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Aggressionen
- depressive Reaktionen, Erleben von Scham und/oder Schuld
- Rückzug und Vermeidung traumaassoziierter Stimuli
- Substanzmissbrauch (z.B. Alkohol oder Benzodiazepine)
- Derealisation (verändertes Erleben des Selbst, der Zeit und/oder Realität)
- unspezifische somatoforme Beschwerden, beispielsweise Erschöpfung, Schmerzen, Übelkeit, Blähungen
Frühe Screeningergebnisse nicht überinterpretieren
Screeninginstrumente helfen dabei, Schutz- und Risikofaktoren (siehe Kasten) und/oder psychische Symptome zu erkennen. Auch können Sie eingesetzt werden, um die Indikation für eine Frühintervention zu stellen, so die Leitlinienautoren. Allerdings müsse man symptomorientierte Screenings in den ersten Tagen vorsichtig interpretieren. Schließlich hätten die Beschwerden unmittelbar nach dem Ereignis keine prognostische Bedeutung. Rückschlüsse auf eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) lassen sich also erst mit einem späteren Screening treffen. Nach Abschluss der akuten bzw. frühen Diagnostik sollte man Betroffenen eine spezielle psychotraumatologische Versorgung anbieten. In aller Regel übernehmen das die Fachkollegen mit Zusatzqualifikation, die den Patienten dann in mehreren Sitzungen ausführlich explorieren.Quelle: S2k-Leitlinie „Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung“, AWMF-Register-Nr. 051-027, www.awmf.org