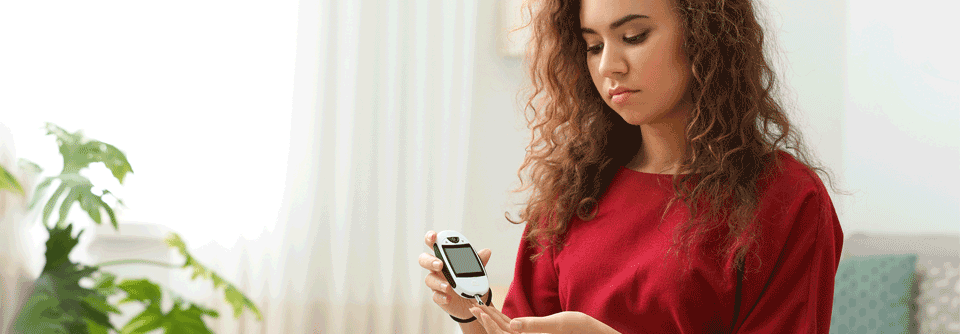Muskeltraining und Insulinwirkung Typ-1-Diabetes beim Sport sicher managen
 Auch Menschen mit Typ-1-Diabetes profitieren von den vielfältigen Vorteilen körperlicher Aktivität.
© Goffkein - stock.adobe.com
Auch Menschen mit Typ-1-Diabetes profitieren von den vielfältigen Vorteilen körperlicher Aktivität.
© Goffkein - stock.adobe.com
Wenn Patientinnen und Patienten mit Typ-1-Diabetes Sport treiben, besteht eine erhöhte Gefahr für Hypo-, unter Umständen auch für Hyperglykämien. Aus Angst davor meiden viele Betroffene starke körperliche Anstrengung – dabei überwiegen die positiven Effekte von regelmäßigem Sport die Risiken.
Sport wirkt sich positiv auf den Fettstoffwechsel aus, senkt das kardiovaskuläre Risiko und verbessert die Insulinempfindlichkeit. Außerdem steigert er das Wohlbefinden, schreibt eine Autorengruppe um Dr. Johanna Kramme, Abteilung für Endokrinologie, Uniklinik Köln. Von diesen Vorteilen profitieren auch Menschen mit Typ-1-Diabetes. Folglich lohnt es sich, sie so zu beraten, dass sie sich beim Training sicher fühlen können.
In erster Linie müssen Patientinnen und Patienten ihren Insulinbedarf kennen und wissen, wie ihr Körper auf Nahrungszufuhr und körperliche Bewegung reagiert, so das Expertenteam. Denn das kann individuell sehr unterschiedlich sein. Hilfreich dafür ist ein Tagebuch, in dem Art, Intensität und Tageszeit der Aktivität, das noch aktive Insulin im Körper und die Veränderung der Blutglukose bei Belastung festgehalten werden. Der Sport wirkt über verschiedene Mechanismen auf den Stoffwechsel.
Gesteigerte Glukoseaufnahme
Die Muskelkontraktionen beim Sport fördern über einen insulinunabhängigen Signalweg die Glukoseaufnahme in den Muskel – und zwar bis um das 50-Fache. Wird gleichzeitig Insulin von außen zugeführt, droht schnell eine Unterzuckerung. Die Level-1-Hypoglykämie ist definiert durch Glukosewerte unter 70–54 mg/dl (3,9–3,0 mmol/l). Unterschreitet der Spiegel 54 mg/dl (3 mmol/l), spricht man von einer Level-2-Hypoglykämie, die sich oft bereits einschränkend auf die Kognition auswirkt. Ist Hilfe von außen notwendig, liegt eine schwere Hypoglykämie vor.
Vermehrte Insulinfreisetzung
Durch Bewegung erhöht sich die Temperatur des Unterhautfettgewebes. Gleichzeitig wird die Subkutis durch die Muskelaktivität massiert. Beides steigert die Insulinfreisetzung der subkutan liegenden Insulindepots nach Injektion. Bei intramuskulärer Insulinapplikation geht es sogar noch schneller. Auch wenn die Insulindosis reduziert wird, fällt der Blutzuckerspiegel deshalb ca. 45 Minunten nach Beginn der Aktivität ab – bei Trainierten mehr als bei Untrainierten.
Ketoazidose-Gefahr
Die Risiken hängen auch von der Art der Belastung ab. Längeres aerobes Ausdauertraining mit leichter bis mittlerer Intensität (z. B. Joggen, Radfahren) lässt den Blutzuckerspiegel abfallen. Bei hochintensivem anaeroben Training (z. B. Gewichtheben, Kampfsport, Zirkeltraining) steigt dagegen der Blutzucker durch die vermehrte Ausschüttung von Katecholaminen, Kortisol und Wachstumshormonen an. Wurde zuvor die Insulindosis zu stark reduziert, droht eine Ketoazidose. Während intermittierender Belastungen (z. B. Fußball, Tennis, Intervalltraining) kann der Glukosespiegel ansteigen und abfallen. Bei intensivem Training kommt es mitunter zur Hypoglykämie, wenn die Glykogenspeicher leer sind, auch noch bis zu 24 h nach der Belastung.
Welche Vorsichtsmaßnahmen vor, während und nach dem Sport ergriffen werden sollten, hängt also von der Art des Trainings und der individuellen Reaktion darauf ab. Auch psychischer Stress vor einem Wettkampf kann für manche Sporttreibenden eine Rolle spielen und den Glukosewert in die Höhe treiben.
Ein gutes Monitoring ist die Grundvoraussetzung, am besten über kontinuierliche Messsysteme (CGM). Die Geräte zeigen die Blutzuckerwerte allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von bis zu 20 min an. Wichtig ist daher, auch auf den Trendpfeil zu achten, der den weiteren Verlauf vorhersagt.
Vor dem Sport die Dauer und Intensität planen
Erwachsenen, die CGM-Sensoren nutzen, wird gemäß den Leitlinien der European Association for the Study of Diabetes (EASD) bei mittlerer Trainingsintensität folgendes Vorgehen empfohlen:
- Vor dem Sport sollte man sich über die Dauer und Intensität im Klaren sein. Nicht zu viel aktives Insulin im Körper ist hilfreich – die letzte Kohlenhydrataufnahme sollte ≥ 90 min zurückliegen, idealerweise mit reduziertem Bolus.
- Der Blutglukosespiegel sollte im Bereich 126–180 mg/dl liegen (7–10 mmol/l) und Messungen alle 15–30 min erfolgen.
- Das Mahlzeiteninsulin lässt sich je nach geplanter Intensität um 25 % bis maximal 75 % reduzieren. Zusätzlich können Kohlenhydrate 30–60 min vor dem Sport zugeführt werden (je nach Ausgangsglukosewert und Trend).
- Blutzuckerwerte über 270 mg/dl (15 mmol/l) erfordern eine Messung der Ketonkörper im Blut: Bei > 1,5 mmol/l heißt es, das Training zu stoppen. Zusätzlich bedarf es ggf. einer Bolusinsulingabe. Unter diesem Wert kann leichtes aerobes Training erfolgen, um einen weiteren Glukoseanstieg zu vermeiden.
- Die Aktivität beenden sollte man auch bei Blutglukosewerten unter 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Liegt der Wert unter 126 mg/dl (7 mmol/l), helfen 10–15 g schnell wirksame Kohlenhydrate, bei leicht nach unten zeigendem Trendpfeil dürfen es 15–25 g sein und bei deutlich nach unten weisendem Pfeil 20–35 g.
- Die Alarmgrenzen des CGM-Systems sollten auf < 100 mg/dl (5,6 mmol/l) und > 180 mg/dl (10 mmol/l) eingestellt werden.
- Weil der Blutzucker auch nach dem Sport noch abfallen kann, sollte alle 15–30 min eine Messung erfolgen. Bei Sensorwerten unter 54 mg/dl (3 mmol/l) sollte eine blutige Kontrollmessung erfolgen und sollten ggf. schnellwirksame Kohlenhydrate zugeführt werden.
- Wurde die Basalinsulinrate reduziert (je nach Insulinart nicht unbedingt erforderlich), muss der Patient oder die Patientin daran denken, den Normwert wieder einzustellen. Nach abendlichem bzw. langem Ausdauersport wird zu einer reduzierten Insulingabe zur Nacht geraten, um Hypoglykämien zu vermeiden (Alarm auf < 80 mg/dl bzw. < 4,4 mmol/l, ggf. auch höher einstellen; mindestens einmal zwischen 0 und 3 Uhr messen).
Quelle: Kramme J et al. Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 905-916; doi: 10.1055/a-2500-5830