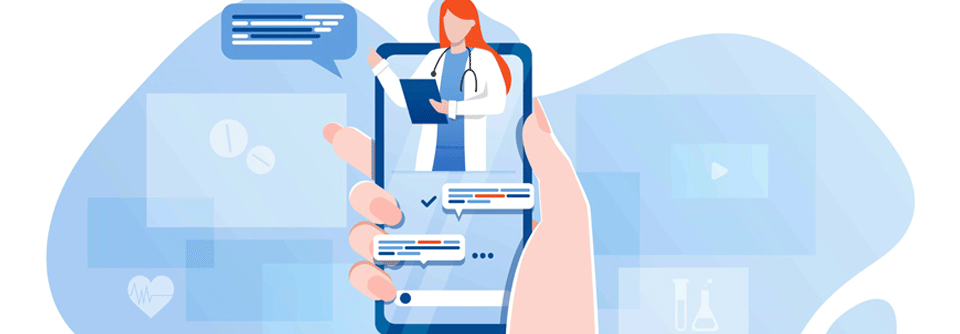Digitale Gesundheitsanwendungen Kritik an mangelnder Einbeziehung der Ärzteschaft und dem schleppenden Zulassungsprozess
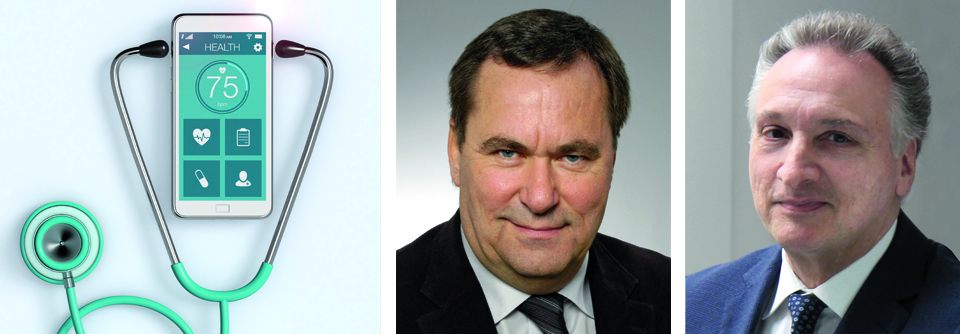 Dr. Andreas Thomas (links) und Manuel Ickrath äußern Kritik an der mangelnden Einbeziehung der Ärzteschaft bei der Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen und am schleppenden Zulassungsprozess.
© lucadp – stock.adobe.com; privat
Dr. Andreas Thomas (links) und Manuel Ickrath äußern Kritik an der mangelnden Einbeziehung der Ärzteschaft bei der Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen und am schleppenden Zulassungsprozess.
© lucadp – stock.adobe.com; privat
Wie steht es um die Implementierung digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) im Gesundheitswesen und speziell in der Diabetologie? Gregor Hess, Redakteur der MedTriX Group, hat dazu Manuel Ickrath und Dr. Andreas Thomas interviewt, beide sind diesbezüglich beratend an der Entwicklung eines Datenmanagementsystems beteiligt und gleichzeitig auch Mitglieder der Redaktion im diatec journal. Manuel Ickrath ist außerdem Mitglied in der Kommission Digitalisierung der Deutschen Diabetes Gesellschaft.
Seit September des Jahres 2020 können digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) den Patienten auf Rezept verschrieben werden. Zunächst konnte das als großer Fortschritt bewertet werden, denn plötzlich ergab sich die Möglichkeit, diesen mit elektronischen Hinweisen auf ihre Smartphones Unterstützung beim Management ihrer Erkrankung zu geben. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Manuel Ickrath: Zunächst muss man sagen: sehr positiv. Es ergab sich damit erstmals die Möglichkeit, für den großen Aufwand bei der Erstellung und Programmierung eines Programms zum Gesundheitsmanagement auch eine Kostenerstattung zu bekommen. Allerdings hat sich gezeigt, dass damit erst einmal nur der erste Schritt getan wurde.
Dr. Andreas Thomas: Man muss es auch noch etwas anders sehen: Hiermit wurde in Deutschland zunächst nachgeholt, was in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, schon viel länger „State of the Art“ ist. Aber es war erst einmal der richtige erste Schritt.
Worin sehen Sie hierbei die Unterschiede zu einem Land wie zum Beispiel den USA?
Manuel Ickrath: Dort ist die Notwendigkeit für digitale Gesundheitsanwendungen deutlich höher als in Deutschland. Die USA sind ein Flächenland. Außerhalb der großen Städte ist die Arztdichte zum Teil gering. Man denke da zum Beispiel an einem Flächenstaat wie Arizona. In Deutschland ist die Arztdichte vergleichsweise deutlich höher. Aber: Wir werden in Deutschland in naher Zukunft auch dieses Problem zu spüren bekommen – und zwar massiv. Viele Arztpraxen schließen wegen des Renteneintritts der Behandler und bekommen keine Nachfolger. Im Gegensatz dazu wird zum Beispiel bei immer mehr Menschen der Diabetes mellitus diagnostiziert (deutlich beim Typ-2-Diabetes, aber auch die Inzidenz des Typ-1-Diabetes nimmt zu), die eine entsprechende ärztliche Hilfe benötigen. Die digitalen Gesundheitsanwendungen könnten hier eine wichtige Unterstützung sein, um zukünftig die Betreuung der Menschen mit Diabetes aufrechtzuerhalten.
Welche Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie da speziell?
Dr. Andreas Thomas: Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, die Patienten medizinisch zu beraten, ohne dass sie die Arztpraxis aufsuchen müssen. Unter optimierten Umständen können damit mehr Patienten pro Zeiteinheit behandelt werden. Und es ist natürlich auch für die Patienten bequemer, wenn sie im ländlichen Raum wohnen und sich eine aufwändige Reise zu einer fern gelegenen diabetologischen Schwerpunktpraxis sparen können. Das betrifft natürlich vor allem den Routinefall, nicht zum Beispiel eine Neueinstellung. Das sehr wichtige Arzt-Patienten-Verhältnis ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Aber zumindest lassen sich die unmittelbaren Praxisbesuche auf das notwendige Maß reduzieren. Natürlich setzt das auch voraus, dass das elektronische Rezept den Durchbruch schafft. Davon sind wir aber auch noch weit entfernt.
Manuel Ickrath: Ein wesentlicher Vorteil könnte auch sein, dass über die Digitalisierung die Daten der Patienten sowohl ihnen, als auch dem behandelnden Arzt jeder Zeit online zur Verfügung stehen können. Das ermöglicht ein zielgerichtetes Behandeln und auch ein telemedizinisches Coaching. Allerdings ist genau dieser wichtige Aspekt bei den in Deutschland zugelassenen DiGA nicht vorhanden.
Aus dieser Sicht müssten ja eigentlich alle digitalen Gesundheitsanwendungen mit Freude begrüßt und genutzt werden, oder?
Manuel Ickrath: Die nach wie vor geringe Verbreitung von DiGA hat verschiedene Ursachen. Aktuell sind im aktuellen Verzeichnis in Deutschland wohl 33 DiGA gelistet, 14 davon dauerhaft und 19 vorläufig. Von den insgesamt 157 gestellten Anträgen wurden 86 zurückgezogen. Das zeigt schon eines der Probleme, nämlich dass der Zugang zur Zulassung einer DiGA schwierig ist. Wenn wir den Diabetesbereich betrachten, so sind derzeit nur zwei DiGA vorhanden, Hello better Depression & Diabetes sowie Vitadio und zwar als vorläufige Zulassung. „Esysta“, eine bereits schon einmal eingeführte DiGA, ist wieder zurückgezogen worden. Dann gibt es nur noch zwei DiGA namens „Zanadio“ und „Oviva“, die für Adipositas und auch Diabetes Bedeutung haben kann. Mehr ist nicht vorhanden.
Dr. Andreas Thomas: Es gibt aber noch eine Reihe anderer Probleme. Eines davon liegt im Preis für eine DiGA. Diese zu erstellen muss für deren Entwickler auch einigermaßen kostendeckend sein. Entsprechend sind die Preise im ersten Jahr hoch. Ein Arzt, der die Stoffwechseleinstellung eines Menschen mit Typ-2-Diabetes über die Gewichtsabnahme unterstützen möchte, kann zum Beispiel ein GLP1-Medikament rezeptieren. Obwohl teuer, ist das immer noch preiswerter als eine DiGA zu verordnen, auch wenn Letztere sich nicht in seinem Medikamentenbudget niederschlägt. Der Arzt muss entscheiden, ob er das eine oder das andere bevorzugt. Und manche werden mit ihrer Entscheidung für eine DiGA im Hinblick auf den Preis eher zurückhaltend sein.
Nun haben wir über die preisliche Differenzierung zu Medikamenten gesprochen. Das erklärt aber nicht, warum so wenige DiGA zugelassen sind.
Manuel Ickrath: Eine DiGA wird nur zugelassen, wenn sie absolut patientenzentriert aufgebaut ist. Was bedeutet das? Der Patient soll im Alltag von seiner DiGA Hinweise erhalten, zum Beispiel zu mehr Bewegung, weil festgestellt wird, dass zu wenige Schritte pro Tag gelaufen wurden. So etwas mag für die Gewichtsabnahme vernünftig sein. Der Mensch mit Diabetes benötigt aber Informationen über das Management seines Stoffwechsels, soll die DiGA ihn unterstützen. Dort würde ihm einerseits die Wechselwirkung mit seinem Arzt helfen. Aber genau das ist bei den DiGA in Deutschland nicht möglich, sollen sie als solche auch zugelassen werden. Das Thema ist aber noch umfassender: Es dürfen gar keine therapeutischen Empfehlungen gegeben werden, wie zum Beispiel der Vorschlag zu einem Insulinbolus auf Grundlage gemessener Glukosewerte, ermittelt über einen Bolusrechner. Die Kostenträger dürfen nur DiGA in den Risikoklassen 1 und 2a zulassen und das schließt eben zum Beispiel einen Insulinbolusvorschlag aus. Das ist aber eigentlich gerade das, was mancher Patient benötigt.
Dr. Andreas Thomas: Schaut man sich die vielfältigen Studien in der Literatur an, so sind eine Reihe erfolgreicher digitaler Gesundheitsanwendungen gezeigt worden. In der Regel fand dort das Zusammenspiel zwischen Arzt und Patient statt, also genau das, was in Deutschland bei den DiGA ausgeschlossen wird. Zukünftig wird es sogenannte Patienten-Entscheidungssysteme geben, d.h. die Entwicklung geht in diese Richtung. Dort werden die Möglichkeiten der Digitalisierung ausgelotet, nämlich konkrete Vorschläge für das Therapiemanagement für den Anwender des PDSS. Das heißt, er bekommt in einer speziellen Situation einen Vorschlag zu seiner Therapie. In Deutschland sind wir mit den gegebenen Zulassungsbeschränkungen für DiGA weit davon entfernt. DiGA im Sinne einer modernen Diabetologie benötigen mehr.
Aber noch einmal zurück: Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat doch vor zwei Jahren die DiGA euphorisch als die zukunftsweisende Innovation gefeiert. Ist von dieser Euphorie noch etwas übrig geblieben?
Manuel Ickrath: Die DiGA ist zweifellos eine hervorragende Idee. Wie viel Zeit verbringt der Patient denn zusammen mit seinem Arzt? Das sind in der Regel wenige Minuten im Quartal. Eine DiGA ist perfekt geeignet, den Link zwischen Patient und Arzt zwischen den Visiten abzugeben. Das Wort Visite weist aber auf den Arzt hin. Und genau dies soll nach der Bestimmung des BfArM nicht sein: Die DiGA soll autonom und autark nur beim Patient wirken! Das ist meines Erachtens ein folgenschwerer Denkfehler der Zulassungsbehörde, denn die DiGA muss in den Behandlungsablauf des Arztes eingebettet sein. Wenn das nicht geschieht, weiß der Arzt von der DiGA nichts – ob sie genutzt wird, ob sie korrekt eingesetzt wird, ob sie tatsächlich dem Patienten einen Nutzen bringt. Viele Ärzte lehnen deshalb die DiGA als Gattung ab, weil sie weder in die Entwicklung einbezogen wurden noch sicher sein können, dass das, was sie rezeptiert haben, auch ordnungsgemäß abläuft. Andererseits aber auch kein Wunder: So etwas kommt dabei heraus, wenn Produkte wie DiGA entwickelt werden, aber keine Strategie vorhanden ist. Das rächt sich jetzt. Das BMG versucht jetzt nach 2 Jahren DiGA und mehr als 15 Jahren elektronische Patientenakte (ePA), die Digitalstrategie nachzuholen.
Was fehlt also seitens des Gesetzgebers?
Manuel Ickrath: Genauso wie bei der ePA jetzt ein Neustart erfolgt, nachdem vieles schiefgelaufen ist, sollte auch bei den DiGA einiges auf den Prüfstand kommen. Damit meine ich den eben beschriebenen Punkt der besseren Vernetzung einer DiGA mit dem ärztlichen Behandlungsablauf. Generell ist die Vernetzung eine große Chance für DiGA, die zurzeit nicht genutzt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, DiGA mit der ePA zu vernetzen, Schnittstellen hierfür sind einzurichten. Die ePA 2.0 ist aber noch lange nicht in Sicht. Was soll denn bis 2025 oder 2027 mit den Daten aus den DiGA passieren? Wie werden sie genutzt – über den Patienten hinaus? Also bleibt eine DiGA vorerst unvernetzt. DiGA müssen folglich eng in die Neukonzeption der ePA im Rahmen der Digitalstrategie von Frau Ozegowski eingebunden werden.
Was ließe sich noch verbessern?
Manuel Ickrath: Man muss sich auch die Zulassungsbedingungen kritisch anschauen. Dabei meine ich nicht den hohen Evidenzgrad des Nachweises einer Wirksamkeit. Wenn DiGA-Hersteller aus der Regelversorgung finanziert werden wollen, gelten für sie vergleichbare Bedingungen wie bei Medikamenten. Die Anforderungen an den Datenschutz sind aber vollkommen übertrieben hoch, letztlich auch nutzerunfreundlich, weil zu kompliziert im Alltag. Auch hier wird ja in breiterem Rahmen über den typisch deutschen Datenschutz diskutiert. Eine enge Abstimmung mit der ePA 2.0 hilft hier vielleicht auch. Ganz wichtig wäre weiterhin eine verbindliche Verfahrensordnung für die Zulassung, an die sich nicht nur die Hersteller, sondern auch das BfArM zu halten hat – so wie es beim AMNOG ja auch vorgesehen ist. Unzumutbar für die Hersteller sind unter anderem die langen Wartezeiten für Beratungstermine beim BfArM. Die Behörde ist personell unterbesetzt und wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, da sie keine Rücksicht auf die wirtschaftlichen Zwänge nimmt, denen sich die Hersteller zu stellen haben.
Dr. Andreas Thomas: Die Zulassungsbedingungen sind generell schwierig, was durchaus zu verstehen ist. Auf die bloße Zusage, dass eine DiGA sinnvoll ist, kann der Kostenträger nicht die Finanzierung übernehmen. Der Weg über das BfArM ist dabei nur die eine Seite. Es ist ein Weg, der eine vorläufige Zulassung einer DiGA ermöglichen soll, mit der Auflage, den Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit innerhalb eines Jahres mit einer randomisierten, kontrollierten Studie zu erbringen. Wenn aber die gerade von Manuel Ickrath beschriebenen Zulassungsbedingungen häufig geändert werden, wird es unkalkulierbar. Und noch einmal: Es darf nicht vergessen werden, dass die Entwicklung einer DiGA aufwändig ist, eine randomisierte, kontrollierte Studie durchzuführen ebenfalls. Damit ist das Ganze für den DiGA-Entwickler/Hersteller enorm teuer, bei nicht garantiertem Erfolg. Das führt zur Zurückhaltung.
Sind Sie trotzdem optimistisch, dass DiGA einmal ein wichtiger Baustein im Digitalisierungskonzept unseres Landes sein können?
Manuel Ickrath: Grundsätzlich ja, denn die Idee ist zweifelsohne bestechend. Eine DiGA kann in hervorragender Weise zwischen den Visiten wirken und damit das Arzt-Patienten-Verhältnis stärken. So weit sind wir aber noch lange nicht. Andernfalls hätten wir mehr als nur 33 DiGA am Markt, von denen die Mehrzahl auch erst vorläufig zugelassen ist, und wesentlich mehr Verschreibungen durch die Ärzteschaft. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber mit seiner Digitalstrategie zügig ernst macht, und die DiGA darin einbettet.
Dr. Andreas Thomas: Ich bin mir da nicht sicher. Unbürokratische Prozesse zur Zulassung sinnvoller Innovationen erleben wir in unserem Land eher selten. Ich glaube, dass der Druck auf die Gesundheitsversorgung durch eine abnehmende Arztdichte bei wachsenden Patientenzahlen steigt. Die harte Realität wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen treiben, und glücklicherweise gibt es nach wie vor Menschen, deren Visionen sich nicht durch Schwierigkeiten erschüttern lassen.